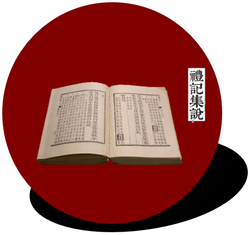Oesterreichische Gegenwartsliteratur ab 1990 Schmidt-Dengler 2006
WERKINFORMATION
Vorlesungsskript von Prof. Wendelin Schmidt-Dengler zur österreichischen Gegenwartsliteratur. Sprache des Werks: Deutsch. Version: 1.
- Österreichische Gegenwartsliteratur ab 1990 Notizen zur Lehrveranstaltung.
- Schmidt-Dengler-Wendelin
- 2006 2006
- Nicht-exklusives Nutzungsrecht von Autor Vorlesungsskript
- Graues Werk
Zitierhilfe: Zitiere diese Inhalte in verschiedenen Zitierstilen. Archivkopien aller Inhalte finden sich auch im großartigen Internet Archive (Spenden).
QUERVERBINDUNGEN
Verbindungen mit Personen, Orten, Dingen und Ereignissen finden sich unter Themen und Schwerpunkte.
TAGS & KATEGORIEN
Herzlichen Dank an Professor Schmidt-Dengler für das Bereitstellen dieses Textes für das eLib-Projekt.
- Wendelin Schmidt-Dengler
- ÖSTERREICHISCHE GEGENWARTSLITERATUR AB 1990
- Notizen zur Lehrveranstaltung
Einleitung
Es versteht sich von selbst, daß jede Vorlesung den Standpunkt, von dem aus sie gehalten wird, reflektiert, und zwar reflektiert in einem Doppelsinne: Widerspiegelt und zugleich mitbedenkt. Spätere Leser dieses Textes mögen die Erregung gar nicht verstehen, die nahezu bei der Betrachtung eines jeden Textes sich einstellt, denn das, was österreichische Literatur ist und leisten kann, diese Debatte hat durch die Ereignisse um den 4. Februar dieses Jahres eine geradezu peinliche Brisanz bekommen. So wenig es mir ansteht, den Gegenstand Literatur nur unter dem Blickwinkel der Politik und im besonderen der gegenwärtigen politischen Lage zu betrachten oder gar hier in eine bestimmte Richtung Propaganda betreiben zu wollen, so wenig scheint es mir zulässig zu sein, gerade diesen Rahmen nicht berücksichtigen zu wollen; so sehr es wichtig ist, diese Texte als Literatur zu verstehen und in der Art, in der sie angefertigt sind, zu würdigen, ihre Machart zu beurteilen, so wenig ist es nun möglich, diese Machart abzulösen von dem, was in diesem Lande vorgefallen ist und immer noch vorfällt. Ich möchte die Vorlesung nicht auf die politische Diskussion abstellen; es geht auch darum, das zu würdigen, was die Literatur als Literatur leistet, aber ich sehe mich nicht imstande, den Gegenstand antiseptisch zu behandeln und so zu tun, als könnte ich ihn herausnehmen aus der Debatte, in der wir nun alle und nahezu täglich befangen sind.
Die Literatur selbst führt dorthin, denn gerade in den letzten Jahren hat diese Literatur sehr wohl das politische Geschehen in einem Ausmaß explizit thematisiert, das vordem nicht da war. Die apolitische Haltung der Autoren, der Tod des Nachsommers, die Windstille, die in dem Lande herrschte, die sozialpartnerschaftliche Ästhetik – all das waren die gängigen Etikettierungen, mit denen jedes Produkt als Made in Austria abgesegnet wurde. Lassen sich diese Etiketten noch immer bedenkenlos auf jedes literarische Produkt aus Österreich aufkleben, so als ob nichts gewesen wäre, so als ob es 1989 nicht gegeben hätte, so als ob es den Jänner 2000 nicht gegeben hätte? In der Tat – wir haben es mit einer anderen Literatur zu tun, und wer die Literatur aus Österreich in den letzten zehn Jahren mit einiger Aufmerksamkeit gelesen hat, der wird darin sehr wohl den Status der Republik Österreich vorgezeichnet finden, mit dem wir uns jetzt auseinanderzusetzen haben. Denn Literatur vermittelt nie direkt etwas, aber sehr wohl kann aus diesen komplexen Texten eine triftigere Diagnose abgeleitet werden als aus den gerade im Schwange befindlichen Schlagwörtern, mit denen uns die Medien, indem sie die Verantwortlichen zitieren, zuzudecken suchen.
Es liegt mir ferne, daraus nun eine Diskussionsrunde über die gegenwärtige parlamentarische Situation in Österreich zu machen, dazu bin ich fürwahr nicht berufen, sehr wohl aber geht es mir darum zu zeigen, wie das kritische Sensorium der meisten Autoren das vorgezeichnet hat, was nun an der Tagesordnung ist. Zugleich scheint den Politikern bewußt zu sein, daß Literatur und das Schreiben etwas ist, das wie kein anderes Instrument die Bewußtseinslage zwar nicht der Wähler, sehr wohl aber der kritischen Intelligenz bestimmbar macht, und es ist schwer, wenn schon nicht für den Augenblick, so in jedem Falle auf die Dauer, unter Mißachtung diese Intelligenz Politik zu machen. Das heißt, die Autoren haben in unserer Mediendemokratie eine Funktion in der Öffentlichkeit, die, mag sie auch abschätzig beurteilt werden, doch das Widerlager zu jeder veröffentlichten Doktrin darzustellen hat.
Wieso hat sich denn niemand anderer als Jörg Haider in seiner Rede nach der Wahl zum Obmann der FPÖ gerade auf eine Autor berufen, der derzeit zum Inbegriff dessen geworden ist, was man als Literatur aus Österreich wahrzunehmen gewillt ist? Da hört man:
Wir dulden auch keine Österreichbeschimpfungen, wie sie üblich geworden ist. Denn es ist traurig, daß subventionierte Schriftsteller in diesem Land ihre Bücher damit füllen, so wie ein Thomas Bernhard kürzlich wieder mit seinem jüngsten Buch 'Auslöschen'[!], in dem er Zensuren für diese Republik erteilt und alles in und alles in Grund und Boden verdammt, was die Grundlage auch seiner materiellen und geistigen Existenz in dieser schönen Heimat ist. Eine Ankündigung, die so ja nicht Wirklichkeit wurde. Ehe wir dieses nicht eingehaltene Wahlversprechen einklagen wollen, möchte ich auf ein anderes Szenario, vierzehn Jahre später verweisen: Der hier Redende wurde 1999, unmittelbar nach dem 3. Oktober eingeladen, bei einer Veranstaltung der Bildungsakademie der Freiheitlichen Partei über Die Literatur als Bühne der Politik zu Thomas Bernhard zu sprechen. Welche Schichten von diesem Gesinnungswandel innerhalb der Partei getroffen sind, wage ich vorschnell nicht zu entscheiden, immerhin scheint es so zu sein, daß offenkundig auch auf kulturpolitischem Terrain ein Aufbruch riskiert werden soll, um eine Flanke zu beruhigen, auf der man verwundbar war. »An diesem toten Giganten kommt keiner vorbei«, sagte Elfriede Jelinek in ihrem bemerkenswerten Nachruf auf Thomas Bernhard, und selbst wenn wir es hier nicht unbedingt auf eine Heiligsprechung oder Mythisierung Bernhards abgesehen haben, so wird man doch zugeben müssen, daß mit dem Namen Bernhard ein Diskurs benannt wird, der an der Schnittlinie von Literatur und Politik gelagert ist, und daß kaum ein Autor über das Ghetto des Innerliterarischen hinaus in Österreich so nachhaltig wahrnehmbar und wirksam geworden ist, daß sich etwa Peter Handke genötigt sah, von einer Ära Bernhard sprechen zu wollen und nicht von einer Ära Waldheim, die nach den Unruhen eben des Jahres 1986 im Jahre 1992 sanft zu Ende ging.
Diese Worte Haiders sollten all jenen zu denken geben, die in Bernhard bloß den Schimpfvirtuosen erblicken wollen, der seine endlosen Tiraden genüßlich in sich kreisen läßt und die ihr Genügen in der Verbalinjurie finden. Zumindest vermochten sie Gegentiraden zu provozieren, um – wie in diesem Falle – eine Gesinnung zu fatieren, die im öffentlichen Diskurs für überwunden gelten konnte.
Damit wäre das prekäre Verhältnis nicht nur zwischen Thomas Bernhard und Österreich, sondern das prekäre Verhältnis zwischen Literatur und politischer Gegenrede angerissen; das bedarf nach wie vor einer eingehenden Analyse, die freilich in einer Vorlesung allein nicht zu leisten ist, die jedoch hier mit Ausblick auf andere Autoren für die Situation nach Bernhard erbracht werde soll. Bernhards Österreich-Kritik verdient ebenso wie die seiner Kolleginnen und Kollegen eine differenzierte Darstellung, die endlich auch die Klischees von Netzbeschmutzung, Haßliebe und Raunzerei hinter sich läßt, und damit auch die allzu bequem vorzunehmende »Einordnung« in die bekannte Ahnenreihe der wortmächtigen österreichischen Raisonneure, von Abraham a Sancta Clara über Nestroy und Karl Kraus bis zu Qualtinger.
Zusammenhänge
Mir kommt es im nun folgenden darauf an, nicht einen »Überblick« zu geben; es fällt mir schwer, etwa jahrweise vorzugehen und so mit dem »book of the year« einfach annalistisch jedes Jahr kommentierend zu begleiten; ich verfüge nicht über diese Übersicht, die es mir erlauben würde, zu disponieren und von Jahr zu Jahr an einem einschlägigen Beispiel das zu behandeln, was die jeweilige literarische Situation ausmachte. Jedoch wie die Zusammenhänge herstellen, die doch eine Vorlesung bestimmen sollten, wie den Leitgedanken konturieren? Am einfachsten wäre es freilich, einfach chronologisch vorzugehen, Werke und Autorinnen wie Autoren namhaft zu machen und einen Kurzkommentar zu geben. Das wäre bequem, aber nicht sonderlich förderlich. Ich habe mich entschlossen, anhand von ein paar Texten Zusammenhänge sichtbar zu machen; etwas großspuriger ausgedrückt: Es geht mir um die Intertextualität, es geht mir darum zu zeigen, wie diese Texte untereinander verbunden sind, wobei es nicht darauf ankommt, diesen Kontext durch ein bestimmtes Zitat denn auch durchgehend herzustellen, gleichsam die Autoren voneinander abschreibend zu präsentieren, sondern eben zu zeigen wie die einzelnen Texte aufeinander antworten, wie sich durch Motive, literarische Verfahren und auch sehr konkrete Echos doch so etwas ergibt wie einen immanenter Zusammenhang, der weitaus mehr aussagt als eine bloße Befragung der Inhalte. Um diese werde ich mich auch nicht herumdrücken können, so es diese in einer Form gibt, daß sie auch transportierbar sind.
Um ein Beispiel anzuführen: Überall ist vom Ende, von der Katastrophe die Rede. Ehe man aber einfacherweise dahinter so etwas vermuten will wie die Stimmung zum Ende eines Jahrhunderts, scheint es angebracht, sich doch zu fragen, welche konkreten Anlässe oder welche abstrakten Motivationen dafür verantwortlich sind, daß etwa in vier großen Romanen – und zwar in Jelineks Die Kinder der Toten, in Ransmayrs Morbus Kitahara, in Menasses Schubumkehr und schließlich in Haslingers Opernball – eine vor allem das Finale beherrschende Katastrophenstimmung durchschlägt, und zwar in Büchern, die durchgehend aus dem Jahre 1995 stammen? Das ist just jenes Jahr, in dem Österreich auf der Frankfurter Buchmesse das Schwerpunktland war, jenes Jahr, in dem Österreich nach langem seine neue europäische Identität begreifen und fassen konnte. Das letzte Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts brachte nun eine Literatur mit sich, die sich auf die politische Situation ganz anders einzustellen hatte. Der Beitritt Österreichs zur EU hat nicht nur die österreichische Identität und ihre Bestimmung unter neue Akzente in einem außen- und innnenpolitischen Sinne gestellt, sondern bedeutet auch nachhaltige Reflexion auf die Möglichkeiten des künstlerischen Diskurses.
Wenn ich in dieser Vorlesung des öfteren davon spreche, wie wichtig der Außenstandpunkt für das Schreiben wurde, so bekommt das im Zusammenhang mit der EU und mit der Selbstbestimmung Österreichs eine ganz neue Wertigkeit. Hier bitte ich sie mitzudenken, sich auch zu fragen, wieso denn so viele österreichische Autoren ihre Helden reisen lassen. Menasse und Ransmayr reisen nach Japan, Gerhard Roth nach Japan und Griechenland, Elisabeth Reichart nach Japan, Haslinger nach Amerika und die USA; in seinem Projekt Homer absolut (1995) ließ Walter Grond die Schriftsteller gar die Reisen des Odysseus nachreisen, nach Vorgabe einer Wiener Dissertation, die die Odyssee als erste Weltumsegelung zu enttarnen meinte.
Was soll man auch dazu sagen, daß in allen Texten so viel vom Müll die Rede ist? Ich habe oft den Verdacht, daß wir es in diesen Texten mit Ablagerungsstätten zu tun, mit Sprachmüllhalden. Immer wieder ist von diesem Müll, von den Abfällen die Rede, kurzum das Undelikate hat seine Dominanz – das ist doch, wenn es in ganz unterschiedlichen Texten wie bei Werner Schwab, Elfriede Jelinek, Peter Handke, Marlene Streeruwitz, Robert Menasse und Wolf Haas vorkommt, einmal zu beschreiben und zu erklären. Wohin mit den extremen Verzerrungen der Standardsprache bei Haas, Jelinek, Streeruwitz, Schwab? Sie merken, ich wähle schon die Autoren an, die in den neunziger Jahren im Gespräch über die österreichische Literatur repräsentativ wurden. Wie paßt da die extrem vulgäre Sprache in Ernst Jandls stanzen dazu?
Ich bin als Literaturwissenschaftler verpflichtet, die Gesetze des wissenschaftlichen Vorgehens zu berücksichtigen. Ich bin verpflichtet, jeweils mein Vorgehen von der Methode her zu rechtfertigen. Daß die Methode nie rein und unbefleckt zu bewahren sein wird, ist mir klar, nur möchte ich mein Vorgehen jeweils erklären, nicht aber die Erläuterung der Methode an den Anfang stellen, sondern von Mal zu Mal die Methode wählen, die dem Gegenstande am angemessensten erscheint. Ich meine, daß die Analyse von literarischen Werken immer die strenge Beachtung der Formensprache der Literatur erfordert; es kommt also darauf an, so genau wie möglich sich um die formalen Fragen zu kümmern, d.h. um das Funktionieren dessen, was man als Gattungen oder – in einem engeren Sinne – als Genres verstehen kann. Eine solche Vorgangsweise empfiehlt sich besonders angesichts einer Literatur, die gerne mit dem Label »postmodern« versehen wird. Wobei es uns freilich darauf ankommt, dieses »Postmoderne« nicht unbefragt vorzustellen, sondern sehr wohl in seiner Bedeutung für die jeweilige historische Konstellation zu charakterisieren. Als Literaturwissenschaftler kann ich auf die Herstellung von Kausalität nicht verzichten; d.h. ich muß zumindest in Ansätzen versuchen, solche Zusammenhänge zu erklären, die Gründe für solche Entwicklungen, wie ich sie oben angedeutet habe, namhaft zu machen. Ich will nicht mit dem systemtheoretischen Brecheisen in die stille Hütte der Literaturwissenschaft eindringen, sehr wohl aber fragen, welche Systeme, die sozialwissenschaftlich beschrieben, politologisch benannt, literaturwissenschaftlich definiert mir bei der Einkreisung dessen behilflich sind, was wir hier als literarische Produktion aus den letzten Jahren vor uns haben.
Die leidige Frage, ob diese Systeme nun im besonderen Sinne als österreichische auszumachen sind, möchte ich vorerst suspendieren. Es gibt kein Wesensmerkmal, das den österreichischen Roman als Roman von anderen Romanen abhebt. Die Frage, ob nun die Literatur aus Österreich auch als eine österreichische zu gelten habe, halte ich nicht mehr für so brisant; schließlich sind die Unterschiede schlicht durch den Problemhorizont bundesdeutscher und österreichischer Autoren besonders nach 1989 geradezu eklatant geworden: Das hat allerdings auch Folgen gehabt, die die Marktsituation betreffen. Auch darüber sollte an passender Stelle die Rede sein. Daß mit 2000 nun eine neue Phase nicht nur der österreichischen Geschichte, sondern vermutlich auch Literaturgeschichte geschrieben wird, sollte uns hier noch nicht beunruhigen und braucht in dieser Vorlesung nicht Gegenstand sein; unter einem anderen Lichte erscheinen die Produkte der österreichischen Autoren jedoch allemal.
Nicht geändert hat sich die Situation österreichischer Autoren als Autoren eines Kleinstaates; auffallend sind die Versuche, eben die Konzentration auf die Probleme dieses Kleinstaates nun in der Literatur eben auch zu transzendieren. Denn je mehr hier nur Probleme behandelt werden, die nur die Österreicher betreffen, um so enger wird der Kreis jener, die als potentielle Leser in Frage kommen. Der Zirkel dieser Verösterreicherung scheint mir ein ganz besonders fatales Inlandsprodukt zu sein: Je mehr wir uns darauf verwiesen sehen, unsere österreichische Identität zu behaupten, um so mehr konzentrieren wir uns auf österreichische Probleme – und werden damit, so nicht die literarische Gestaltung Substanz hat, über Österreich hinaus allenfalls als Devianzerscheinung interessant. Ein echtes Double-bind, wenn Sie so wollen.
Die Vorlesung hat daher die Aufgabe, diese Kohärenz zwischen den Texten glaubhaft zu belegen und zu zeigen, daß Intertextualität eben nicht nur ein Flatus vocis ist, sondern sich sehr wohl als eine Möglichkeit der literaturwissenschaftlichen Spurensicherung bewähren kann. Das ist gewiß ein großer Anspruch, aber ich komme um so einen Anspruch nicht herum; ich erhoffe mir immerhin eine gewisse wechselseitige Erhellung, vor allem aber den Nachweis, daß gerade in diesen Tagen – und vielleicht auch noch in den folgenden – Literatur im öffentlichen und auch im engeren Sinne politischen Diskurs wenn schon nicht eine große, so doch unverwechselbare Rolle spielt und für alle diejenigen, die lesen können, die triftigste Diagnose bereitstellt.
Aufbau der Vorlesung
Ich kann mich nicht, wie bereits gesagt, an die üblichen und so bequemen Schemata halten, die die Chronologie uns zur Verfügung stellt, sondern werde mich vor allem um Gruppierungen bemühen und daher auch in diesem Jahrzehnt die Chronologie hinauf und hinunter eilen. Ich werde mich auch nicht so sehr bei den einzelnen Autoren selbst aufhalten, sondern möchte vor allem mich auf deren Texte konzentrieren. Diese Vorgehensweise ist von der Absicht getragen, Literatur eben nicht nur als einen Anlaßfall für eine politische Debatte zu nehmen, sondern zu zeigen, wie wichtig die Einlassung auf Texte ist.
Daß die Literaturkritik eine problematische Rolle spielt, wird von Fall zu Fall darzutun sein – auch wir haben solche Fälle wie Günter Grass' Das weite Feld (1995), wo schließlich kein Mensch das Buch mehr las, sondern wo man dieses ganz ungestraft in einer leeren Mitte stehen ließ. Ich beginne mit Thomas Bernhard (Auslöschung) und seinen Erben, wobei ich mich nur punktuell auf einige Phänomene der Intertextualität stützen möchte, auf offene und deutlich erkennbare Responsionen. Es kommt der Opponent von Bernhard zum Zuge, nämlich Peter Handke (Das Spiel vom Fragen oder die Reise ins sonore Land). Ich bespreche in dem einleitenden Kapitel, das sich mit der Intertextualität befassen wird, außerdem kurz einen Text von Christoph Ransmayr (Die letzte Welt) und Werner Koflers Text Am Schreibtisch.
Daß nun eine ganz neue Sicht auf die österreichische Geschichte sich aus diesem Kontext ergibt, soll in der Folge anhand von Schindels Roman Gebürtig (1992) und seines Textes Gott schütz uns vor den guten Menschen (1995) erfolgen. In diese Zeit fällt auch die Beendigung von Gerhard Roths gewaltigem Zyklus Die Archive des Schweigens, wobei ich kurz auf seinen Text Die Geschichte der Dunkelheit eingehen möchte. Dieses Kapitel stellt gleichsam die Grundlage bereit für den Schwerpunkt der Vorlesung, bei der es vor allem um die Bücher des Jahres 1995 geht – die Autoren produzierten marktkonform: Es wurden von allen namhaften Autoren für die Buchmesse Bücher erwartet, und sie lieferten sie auch. Im nächsten Abschnitt wird es um die Neuorientierung im Roman in den neunziger Jahren gehen: Vorweg Peter Handke mit seinem Roman Mein Jahr in der Niemandsbucht (1994), dann die Romane, die vielleicht als die Beispiele für Möglichkeiten des Schreibens in den neunziger Jahren stehen mögen und die allesamt 1995 erschienen sind:
- Josef Haslinger: Opernball
- als Ergänzung Christoph Ransmayrs Prosagedicht Strahlender Untergang (1982) und sein Reisebericht von 1998: Der Weg nach Surabaya)
- Christoph Ransmayr: Morbus Kitahara
- Robert Menasse: Schubumkehr
- Elfriede Jelinek: Die Kinder der Toten
Das nächste Kapitel – Die Avantgarde und ihre neuen Spielarten – geht davon aus, daß die österreichische Literatur wesentlich durch eine Literatur bestimmt ist, die sich nicht um die Konventionen des Erzählens, des Dramas und des Gedichts schert und bewußt die Reflexion auf die Sprache vor jede künstlerische Betätigung stellt, und zeigen möchte, wie die Sprache funktioniert – oder auch nicht funktioniert.
Jandls idyllen (1989) und stanzen (1992), in die das Ich im Gegensatz zu früheren Texen des Autors wieder zurückgekehrt ist, stehen am Beginn dieses Kapitels. Das grosse babel,n, die Bibelumdichtung von Ferdinand Schmatz, setzt dieses Kapitel fort. Schmatz' ambitiöser Versuch, es mit der Bibel, dem Buch der Bücher, aufzunehmen, verdient in jedem Falle Beachtung, weil da schön wie sonst kaum anderswo die Kraft und das Funktionieren solcher sprachkritischer Verfahren auch jenseits der Kategorien des Geschmäcklerischen demonstriert werden kann.
Ich verweise auf die anagrammatische Poesie von Helga Glantschnig und Magdalena Sadlon im Reader, nur um zu zeigen, welche Produktion jenseits der konventionellen lyrischen Verfahren anzusetzen sind. Dazu ist auch die lyrische Produktion einer Elfriede Gerstl zu rechnen (ebenfalls im Reader). In diesen Produkten drückt sich nun ein ganz anderes Selbstverständnis aus, als es aus den Verfahren etwa des (deutschen Autors) Durs Grünbein oder des Österreichers Raoul Schrott erkennbar wird. Zum Vergleich wird im Reader ein Text von Raoul Schrott angeführt. Daß diese Literatur aber eben nicht nur als ein pures l'art pour l'art abzuqualifizieren ist, möge aus den Texten von Franz Josef Czernin und Ferdinand Schmatz hervorgehen, wobei besonders Schmatz Sprache Macht Gewalt durch den doppeldeutigen Titel unsere Aufmerksamkeit verdienen müsste (auch im Reader). Czernin wiederum hat in seinem Buch Anna und Franz (1998) mit Möglichkeiten des Erzählens in der Sprache ausgelotet, die sonst kaum so zur Diskussion gestellt hätten werden können. Zudem ist hier an seine Analyse der kritischen Tätigkeit eines Marcel Reich-Ranicki zu denken. Fröhliche Urstände feierte dieses Verfahren denn auch in den frühen Texten Franzobels, vor allem in dem Text Krautflut, mit dem er 1995 den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann. Und wie vital die alte Avantgarde noch ist, möge Friedrich Achleitners Text Die Plotteggs kommen (1996) belegen, der vorzüglich in den neuen Naturdiskurs hineinpaßt
Neue Formen des Erzählens sind gefragt und so wird sich das nächste Kapitel – Erzählen unter dem Aspekt des Fernen (und Nahen) – vor allem mit der in Österreich zusehends problematisch geworden Einkreisung des Themas beschäftigen, denn hier scheint es so etwas wie eine freiwillig gewählte Selbstbeschränkung zu geben, die sich allmählich als Barriere für die Rezeption von Literatur über die Landesgrenzen hinaus gestaltet. Ich habe bereits darauf hingewiesen, daß die Erzähler einen Standpunkt, einen archimedischen Punkt, meinetwegen, von außen zu gewinnen suchen, von dem aus sie Österreich aus den Angeln zu heben suchen. Sollte vielleicht die literarische Landeswährung kaum mehr konvertibel sein? Braucht es so etwas wie einen Literatur-Euro? Besondere Erwähnung verdient Karl-Markus Gauß' Ritter, Tod und Teufel (1994), weil sich darin die Problematik der sogenannten Intellektuellen vor dem EU-Beitritt am deutlichsten dargestellt findet. Lediglich verwiesen werden kann auf Elisabeth Reicharts Lächeln der Amaterasu (1998) zu verweisen, so wie auch auf Gerhard Roths Romane Der Plan (1998) und der jüngst erschienene Roman Der Berg (2000). Auf den Roman Der See (1997) verzichte ich aus verschiedenen Gründen. Dazu paßt auch als Revision des Ganzen Norbert Gstreins vor kurzem publizierter Roman Die englischen Jahre (1999), die einen kritischen Beitrag zur Diskussion um das Exil darstellen. Ein Seitenblick wäre auch auf Josef Winklers Romane Friedhof der bitteren Orangen (1990), und Domra (1998) sowie auf den Text Das Zöglingsheft des Jean Genet (1992) zu werfen. Ebenfalls zu streifen wären Walter Gronds Absolut Homer (1995) und Michael Köhlmaiers Versuche, die Odyssee nachzuerzählen (Telemach, 1995; Kalypso, 1997) – eben als Produkte, mit deren Hilfe eben von außen und aus großer zeitlicher Distanz die Gegenwart fokussiert werden soll. In diesem Zusammenhang wäre auch Evelyn Schlags Buch Die göttliche Ordnung der Begierden (1998) zu erwähnen, als raffinierte Camouflage bizarren Liebesgeschichte.
Das letzte Kapitel würde ich unter einen Titel stellen, den ich dem letzten größeren hier nicht einläßlich behandelten Prosaband der Friederike Mayröcker entlehne – brütt oder Die seufzenden Gärten (1998) –, wobei entscheidend ist, daß »brütt« eben nicht »häßlich« meint, sondern »roh«. Wir haben es also nicht mehr mit dem Fall einer Ästhetik des Häßlichen und den nicht mehr schönen Künsten zu tun, sondern mit dem Rohen, dem Ungekochten, dem, was hinter den Konventionen liegt, oder damit, wie diese Konventionen abgebaut werden. Es geht um das, was sonst außerhalb der Sprache liegt, um die schonungslose Öffnung der sogenannten Intimsphäre, um ein Sprachmaterial, das in keiner Weise mehr poetabel zu sein scheint und das nun die Literatur mit neuen Energien versorgt.
Hier geht es um Elfriede Jelineks Roman Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr, um Marlene Streeruwitz Theaterstücke, wobei ich vor allem auf Ocean Drive eingehen möchte, um Michael Scharangs Text Das jüngste Gericht ders Michelangelo Spatz und schließlich um Werner Schwabs »Fäkaliendramen« und »Königskomödien«. Zwei Texte seien an den Abschluß gestellt, und zwar die Einkleidung des Schrecklichen in die elegante und neutralisierende Form des Kriminalromans bei Wolf Haas mit Komm, süßer Tod (1998) und schließlich Franzobels bildreicher Roman Scala Santa. Dieser letzte Abschnitt wird mit Streeruwitz, Jelinek und vor allem auch Schwab die Möglichkeiten des Theaters kurz beschreiben, eines Theaters, das wie kaum zuvor die Handlung suspendiert hat und auf szenische Effekte setzt, eines Theaters, das den Körper auf die Bühne bringt, und zwar so, daß alle Euphemismen, mit denen wir unseren Körper erträglich zu machen suchen, ausgelöscht sind. Daß diese neue Roheit eine neue Sanftheit garantiere, sei als Hoffnung wenigstens angedeutet.
Thomas Bernhard und seine Erben: Problemfelder, Werke
Intertextualität
Ich möchte versuchen, die Besonderheiten der österreichischen Literatur empirisch an vier Autoren vorzuführen, deren Schriften, wenn man so sagen kann, untereinander verwoben sind, die einen vitalen österreichischen Intertext ergeben, wenngleich dies nicht nach dem einfachen Modell von wechselseitiger Abhängigkeit nach dem Muster eines Stammbaumes sich vorführen läßt. Vielmehr soll ein Geflecht von Bezügen erkennbar werden, ein Gewirr von Stimmen, in dem dann doch einige unterschieden werden können, in dem einige besonders laut den Ton angeben und denen dann eine mitunter leise Antwort zuteil wird. Ich meine, daß das Phänomen der Intertextualität, gleich welche Vorstellung man sich von diesem Begriff macht, in dem Implosionsraum, der das verhältnismäßig kleine Österreich nun einmal ist, sich einigermaßen gut studieren läßt. Ich bitte Sie daher, sich nun auf vier österreichische Autoren einzustimmen, die meiner Meinung nach für den literarischen Diskurs dieses Landes bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt repräsentativ sind; das ist zunächst Thomas Bernhard (1931-1989), der, obwohl bereits vor zehn Jahren verstorben, immer noch präsent ist, dann – neben Bernhard der bekannteste österreichische Autor der Gegenwart – Peter Handke, dann Christoph Ransmayr, dessen Roman Die letzte Welt (1988) in viele Sprachen übersetzt wurde, und zuletzt Werner Kofler, der gewiß weniger bekannt ist als die zuvor Genannten, der aber durch seine Art von Literatur sehr schön zeigt, wie dicht dieses Beziehungsnetz geknüpft ist.
Thomas Bernhard (1931-1989)
Ich möchte nicht als Schnellhistoriker gelten, aber tatsächlich scheint mit dem Tod Thomas Bernhards so etwas wie eine Zäsur in der österreichischen Literaturgeschichte erfolgt zu sein. Zumindest läßt sich eines festhalten: Kaum ein anderer Autor, der sich auf die Produktion seriöser Literatur einließ, wurde über das Ghetto hinaus, innerhalb dessen Literatur nun einmal wahrgenommen wird, so intensiv wie Thomas Bernhard registriert. Dabei war es gerade die misanthropische Geste der Verweigerung, mit der Bernhard die Aufmerksamkeit auf sich zog. Er figurierte als ein Art Alleinunterhalter auch der österreichischen Bevölkerung und besorgte dies nicht nur durch seine Schriften, sondern auch durch Interviews in gekonnter Selbstinszenierung. Ihm war nichts heilig, und fast um jedes seiner Werke entzündete sich ein Skandal, der die Literaturjournalisten mit Stoff und die Österreicher mit Gesprächsstoff versorgte. Sein Buch Holzfällen (1984) wurde beschlagnahmt, ein einmaliger Sonderfall in der Geschichte der Zweiten Republik: Ein Künstler und ehemaliger Förderer Bernhards fühlte sich erkannt und übel behandelt, und ein Trupp Polizisten rückte aus, um das Buch zu beschlagnahmen. Was von einigen als ein Fall krasser Zensur gewertet wurde, war indes nicht viel anderes denn eine Literaturfarce, in der sich viele lächerlich machten, und von der der Autor am meisten profitierte, denn schließlich wollten nun alle das Buch lesen, das da verboten war, und so wurde es im Versandbuchhandel aus der Bundesrepublik direkt bezogen, und der Umsatz war dementsprechend hoch. Schon im nächsten Jahr folgte der nächste Skandal; mit seinem Buch Alte Meister (1985) hatte Bernhard einen Rundumschlag gegen die österreichische Kulturtradition angesetzt; in diesem Roman, dem er sinnigerweise die Gattungsbezeichnung »Komödie« gegeben hatte, ließ er einen 82jährigen Musikkritiker auf einer Bank im Kunsthistorischen Museum in Wien seine endlosen Tiraden gegen die österreichische Kunst halten; Stifter wurde beschimpft, Mahler als Tiefpunkt der österreichischen Musik bezeichnet, auch Mozart wäre nicht frei von »Unterhöschenkitsch«, Dürer galt als »Ur- und Vornazi«. Grund genug, dies als Bernhards eigene Meinung zu nehmen, und der damalige Unterrichtsminister befand, daß Bernhard ein Fall für die Wissenschaft wäre, und er meinte damit nicht nur die Literaturwissenschaft. Das wurde unter allgemeiner Empörung als ein Vorschlag empfunden, Bernhard der Psychiatrie zu überantworten, und da setzte der Minister korrigierend hinzu, er meine nicht die Psychiatrie, sondern die Psychologie. Als Ende 1987 verlautet wurde, daß Bernhard an einem Stück mit dem Titel Heldenplatz schriebe, schwante der Bevölkerung Böses, und die Kronen Zeitung setzte zu einem Halali auf den Autor an. Von dem Text kannte man so gut wie nichts, aber man war sicher, daß es wieder gegen das gesunde Volksempfinden gehen würde. Als 1986 Jörg Haider – darauf wurde bereits verwiesen – unter dem Jubel seiner Parteifreunde zum neuen Obmann der Freiheitlichen Partei gewählt wurde, ließ er sich gleich mit der Bemerkung vernehmen, daß er solche Autoren wie einen Thomas Bernhard nicht dulden würde, der unsere schöne Heimat beschimpfe. Kurzum, es gelang Bernhard, die Österreicher redend zu machen. Sie wurden allesamt kenntlich, die sich da über Bernhard ausließen; von seinen Büchern war so gut wie gar nicht mehr die Rede, Bernhard war zu einer öffentlichen Figur geworden. Auch wenn er nichts unternommen hatte, so war er für viele bald zu einem Repräsentanten Österreichs avanciert, und je mehr er sich mit seiner Person der Öffentlichkeit entzog, um so mehr schien er sich dieser zu insinuieren. Die letzte Möglichkeit der Verweigerung nutzte Bernhard in seinem Testament, in dem er den die Aufführung seiner Stücke und den Druck, ja sogar die Zitierung seiner Texte in Österreich untersagte. Das war das letzte Nein, das Bernhard den Österreichern zurufen konnte – er hatte sie kollektiv enterbt. Doch nun schlug das Pendel um – Bernhard wurde geradezu heiligmäßige Verehrung zuteil. Er hatte sich heimlich auf dem Grinzinger Friedhof begraben lassen, und sein Grab wurde zu einem Wallfahrtsort, und viele, die zu Lebzeiten nichts von ihm wissen wollten die sich mit ihm überworfen hatten, scheinen nun zu sagen: »Er war unser«, denn der tote Dichter ist allemal ein guter Dichter. Mehr als ein Vierteljahrhundert hatte Bernhard das Publikum unterhalten und gereizt, und mit seinem Tod entstand ein Vakuum. Elfriede Jelinek erklärte, daß an diesem »toten Giganten« niemand vorbeikomme, und Peter Handke, sonst Bernhard durchaus nicht grün, erklärte 1992 anläßlich seines 50. Geburtstags in einem Interview, daß man nicht von einer Ära Waldheim sprechen, nein, man könne von einer Ära Bernhard sprechen.
So viel zu einem Stimmungsbild über die Literatur in Österreich, eben aus den letzten Jahren der Waldheim-Ära, deren Ende vor acht Jahren manche stille Feier gewidmet wurde, so viel auch zur literarischen Situation. Bernhard hat Schule gemacht, das fällt auch solchen auf, die nicht wie Kritiker und Journalisten dazu bestellt sind, Urteile über die Literatur abzugeben. Mit seinen Tiraden hat er vorbildhafte Wirkung, seine Haltung zu Österreich, diese prophetische Geste des Fluches wird von vielen mit mehr oder weniger Geschick kopiert oder parodiert; aber darüber hinaus ist doch festzuhalten, daß er viele Themen und Motive vorgegeben hatte, in denen sich heute noch die Nachfolger üben.
Die dunklen Tonart, auf die der Österreich-Bezug in Bernhard-Texten gestimmt ist, wird übernommen; der Satz – aus dem Stück Heldenplatz (1988), daß es heute in Österreich mehr Nazis als 1938 gäbe, wird geradezu zum variierbaren Leitsatz erhoben. Bernhard war es, der am konsequentesten mit dem Bild, das die Österreicher von sich zu machen liebten, aufräumte. Für ihn war dieses Österreich nicht mehr als eine kleine Alpenrepublik, und als in der Ära Kreisky in den siebziger Jahren diese eine Rolle in der Weltpolitik spielen sollte, mokierte sich Bernhard über Kreisky als den »Salzkammergut- und Walzertito«, ja mehr noch, er meinte, der wäre kein »Sonnenkönig«, sondern ein »Höhensonnekönig«, Akteur in einer Weltkomödie, wo vorne Reagan stünde, und hinten der böse Khomeini herbeischliche. Da würde Kreisky auftreten und sagen: »Die Pferde sind gesattelt!«
Die schöne Natur, die den Österreichern in Form eines verhängnisvollen Zirkelschlusses dazu diente, sich als die Produkte dieser schönen Natur zu dünken, die nun wiederum dazu da wären, diese schöne Natur zu schützen. Der Österreicher ist deswegen gut, weil er in einer schönen Natur lebt, und diese ist schön, weil der Österreicher sie bewohnt. Es gibt wenige Autoren, die so markant gegen diesen Kreislauf des Selbstbetrugs Einspruch eingelegt haben; für Bernhard ist die Natur von Antikörpern durchsetzt, sie ist infam, sie zerstört uns, da wir sie zerstört haben: Der grüne Baum ist eine Illusion, denn diese Bäume sind von Borkenkäfern befallen. Die Natur ist antagonistisch, die Menschen sind gegen die Wirklichkeit konstruiert. Die Menschen leben in Rückzugsräumen; sie leben in der perfekten Isolation, wo weder Natur noch Geschichte an sie heran können, die Chance, sich noch das Überleben wenigstens für eine Zeit zu sichern. Sie sind Gefangene in einer Welt der Zitate – im Grunde ist alles, was gesagt wird, zitiert; sie sind eingeschlossen in eine immer alles zitierende Welt – Intertextualität als Kerker, Sprache als Kerkermeisterin. Bei der Betrachtung der österreichischen Literatur empfiehlt es sich, dieses Ineinander von Sprach- und Literaturdiskurs immer in Rechnung zu stellen. Wenden wir uns kurz dem zuletzt erschienenen Roman Bernhards Auslöschung zu.
Thomas Bernhard: Auslöschung (1986)
Ein paar Andeutungen mögen genügen: Der Held Franz Josef Murau lebt in Rom; er erfährt durch ein Telegramm vom Tod seiner Eltern und seines Bruders, wodurch er zum Alleinerben eines großen Gutes in Oberösterreich wird. Dieses Gut Wolfsegg ist Chiffre für die österreichische Geschichte; hier haben die Eltern gehaust, sie waren Nazis, waren nach dem Zweiten Weltkrieg, so als ob nichts geschehen wäre, praktizierende Katholiken. Der Tod der Eltern und des Bruders gibt Anlaß zur Revision der Familiengeschichte, die ja auch die österreichische Geschichte ist. Das Buch endet mit einem Knalleffekt: Der Held schenkt alles der israelitischen Kultusgemeinde, und das Geschenk wird vom Oberrabbiner Eisenberg angenommen. Am Ende erfahren wir noch, daß der Erzähler Murau von 1934 bis 1982 gelebt habe. Auslöschung – das meint nun, daß mit dem Leben und mit der Tat die österreichische Geschichte denn auch gelöscht ist. Auslöschung, das ist das Werk des Autors; ausgelöscht zu werden hat die österreichische Geschichte. Es wird damit eine Tradition negiert, und Bernhard wie auch alle, die nun mehr oder weniger freiwillig auf sein Werk respondieren, versuchen, der offiziellen Lesart vom harmonischen Verhalten der Österreicher, das auf den Ausgleich der sozialen Gegensätze drang, und damit auch der glückhaften Entwicklung der Zweiten Republik nach 1945 zu widersprechen; hier einen wie immer gearteten Sinn zu vermuten, scheint unzulässig. Bernhard hat in diesem Roman einfach ein Gegensatzpaar verwendet, indem er parabolisch die Legende vom sozialen Frieden zerstört. Der Ich-Erzähler nimmt Partei für die Gärtner gegen die Jäger. Die, die ohne Stimme sind, sollen sprechen können.
Bernhard stattet seine Figuren mit dem scharfen Blick des Misanthropen aus; Misanthropie ist – zumindest in der Variante wie sie in Shakespeares Timon und in Raimunds Rappelkopf in Der Alpenkönig und der Menschenfeind begegnet – immer ein Produkt enttäuschter Philanthropie. Die Enttäuschung an den Menschen wird in die Natur projiziert; die historische Erfahrung wird auf den einfachen Nenner einer Dichotomie gebracht, und so erscheinen bei Bernhard auf der einen Seite die guten Gärtner, auf der andren die bösen Jäger, ein dualistisches, ein manichäisches Weltbild, das keinesfalls darauf aus ist, durch den Erzählvorgang so etwas wie Objektivierung und Gelassenheit herzustellen. Gerade die kohärente Erzählung, die wieder Vertrauen in ihren Gang und damit in den Gang der Welt geben könnte, gibt es bei Bernhard nicht. Ein differenziertes Weltbild gibt es nicht; die Reduktion auf den simplen Gegensatz von Jägern und Gärtnern dient in der Form der Übertreibung dazu, eben etwas kenntlich zu machen. Es geht darum, etwas zu entstellen, um es kenntlich zu machen. So auch den Umstand, daß es in Österreich einerseits die Jäger gegeben habe, anderseits die gejagten, die Opfer. Und es war Ingeborg Bachmann, die als eine der ersten (vor allem in ihrer Erzählung Unter Mördern und Irren) auf diese Teilung der Gesellschaft nach dem Krieg hingewiesen hatte:
Damals, nach 45, habe ich auch gedacht, die Welt sei geschieden, und für immer, in Gute und Böse, aber die Welt scheidet sich jetzt schon wieder und wieder anders. Es war kaum zu begreifen, es ging ja so unmerklich vor sich, jetzt sind wir wieder vermischt, damit es sich anders scheiden kann [...]. In der Tat ist Buch auch im Geiste Ingeborg Bachmanns geschrieben; immer wieder tritt eine Figur namens Maria auf, eine Lyrikerin, die aus der »lächerlichen Provinzstadt« kommt, in der auch »Musil geboren worden ist.« (232) Und die Trennung in Jäger und Gärtner ist nun nicht so sehr eine Simplifizierung im Sinne eines dualistischen oder manichäischen Weltbildes, sondern einfach eine bewußte Reduktion, um in Form der Übertreibung einen Zustand zur Kenntlichkeit zu entstellen: Hier wird geschieden, was geschieden sein sollte; Geschichte erscheint in einer planimetrischen Projektion, einfach aufbereitet. Das Klischee bekommt in der von den Ausdrücken der Ausschließlichkeit und Totalität getragenen Sprache Bernhards so etwas wie eine bewußtseinserhellende Funktion. Eine plumpe Methode, scheint es auf den ersten Blick, aber ihre Wirksamkeit ist ungebrochen. Und so sieht nun die Differenzierung von Jägern und Gärtnern in diesem Roman aus:
Die Jäger waren die Freunde meines Bruders, nicht die meinigen, ich hatte ja meine Gärtner. Im Gärtnerhaus war ich oft, beinahe jeden Tag. Wenn ich ins Gärtnerhaus hinüberging, ging ich zum Volk, hatte ich zu Gambetti gesagt, und das Volk liebte ich. Ich sehnte mich danach und ich fühlte mich nirgends glücklicher. Ich liebte die einfachen Leute, ihre einfache Art und Weise. Genauso, wie ihre Pflanzen, behandelten sie auch mich, wenn ich ihn zu ihnen gekommen war, liebevoll. Sie hatten für meine Bedrängnisse und Nöte Verständnis, genau das Verständnis, das die Jäger mir gegenüber niemals gehabt haben, sie hatten nur immer ihre herrschaftlichen Sprüche für mich parat, glaubten, mir als ganz kleines Kind schon nur ihre anzüglichen Witze erzählen zu müssen, mich mit über ihren Köpfen geschwenkten Schnapsflaschen aufheitern zu können, wo sie mich durch diese abstoßende Art ihres Auftretens nur noch unsicherer und trauriger machten, als ich schon war, im Gegensatz zu den Gärtnern, die mich, ohne viel Wörter, verstanden und mir in jedem Fall helfen konnten. Die Jäger überfielen mich immer schon von weitem mit ihrer protzigen, auftrumpfenden Art, mit ihren lauten versoffenen Stimmen, die Gärtner hatten genau die Sensibilität, die mich beruhigte. Zu den Gärtnern ging ich, wenn ich unglücklicher, als erträglich, war, wenn ich in höchster Not gewesen bin, hatte ich zu Gambetti gesagt, nicht zu den Jägern. In Wolfsegg hatten sich immer zwei Lager gegenübergestanden, die der Jäger und die der Gärtner. Sie haben es jahrhundertelang nebeneinander ausgehalten, was sicher nicht leicht gewesen ist. Ist es nicht interessant, hatte ich zu Gambetti gesagt, daß sich immer wieder ein Jäger umgebracht hat, erschossen natürlich, nie aber ein Gärtner. Auf die Jäger gehen viele Selbstmorde in Wolfsegg, kein einziger auf die Gärtner. Alle paar Jahre erschießt sich auf Wolfsegg ein Jäger und es muß ein neuer gesucht werden. Die Jäger werden auch nicht sehr alt, sie vertrotteln bald, hatte ich zu Gambetti gesagt, und versaufen sich. Die Gärtner auf Wolfsegg sind immer uralt geworden, nicht selten hat ein Gärtner das neunzigste Jahr erreicht, die Jäger treten meistens mit fünfzig ab, weil sie nicht mehr in der Lage sind, ihren Dienst auszuüben. Sie zittern im Anschlag und sie bekommen schon mit vierzig Gleichgewichtsstörungen. Die meiste Zeit sind sie im Ort anzutreffen, wo sie in den Wirtshäusern herumhocken neben ihrem entsicherten Gewehr und ausgefressen ihre absurden politischen Kommentare abgeben, was sehr oft in Raufereien ausartet, die naturgemäß wie immer auf dem Land mit Streit und in der Folge mit Verletzten, ja sogar mit Toten enden. Die Jäger waren schon immer die Radaumacher, die Aufwiegler. Paßte ihnen einer nicht, schossen sie ihn einfach bei nächster Gelegenheit ab und verantworteten sich vor Gericht, sie hätten den Erschossenen für ein Stück Wild gehalten. Die Prozeßgeschichte in Oberösterreich ist voll von solchen Jagdunfällen, die dem Täter meistens nur eine Verwarnung einbrachten nach dem Motto: der von einem Jäger Erschossene ist selbst schuld. Die Jäger waren auch immer die Fanatischen, hatte ich zu Gambetti gesagt, tatsächlich läßt es sich beweisen, daß das Unglück der Welt zu einem Großteil auf die Jäger zurückzuführen ist, alle Diktatoren sind leidenschaftliche Jäger gewesen, hätten alles bezahlt für die Jagd, wie wir ja gesehen haben. Die Jäger waren die Faschisten, die Jäger waren die Nationalsozialisten, hatte ich zu Gambetti gesagt. Im Ort unten führten während der Naziherrschaft die Jäger das große Wort und die Jäger waren es schließlich auch, die meinen Vater zum Nationalsozialismus erpreßt haben. Sie waren, als der Nationalsozialismus aufgekommen ist, die Stärkeren, mein Vater war der Schwächling, der sich ihnen zu beugen hatte. (190-193)
Es ist vor allem die Rhetorik des Gegensatzes, die Bernhards Texte prägt. Die Helden sind von diesen Gegensätzen aufgerieben; dabei ist festzuhalten, daß Bernhard sonst seine Figuren selten so eindeutige Optionen vorbringen läßt – sonst geht es eher darum, durch die Hervorhebung der Alternativen zu beweisen, daß wir bar jeder Alternative sind. Somit scheint man in diesem Gegensatz von Jägern und Gärtnern fast so etwas wie einen Schwachpunkt im Konzept Bernhards orten zu können, soferne man ihn ernst und nicht als eine rhetorisches Räsonieren betrachtet, als eine Kunstform der Scheltrede, die zuletzt geradezu auch karnevalistisch vom Ernst zum Scherz changiert; gerade Bernhards Figurenrede höhlt den Gegensatz von Tragödie und Komödie aus. Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie? – so lautet Titel eines Stückes Kurzprosa aus seiner Feder.
Peter Handke: Das Spiel vom Fragen oder Die Reise ins sonore Land (1989)
Thomas Bernhard sei ein »Raisoneur«, hat Elfriede Jelinek geschrieben, einer der an seiner wütenden Rede erstickt sei, einer, der immer habe reden müssen, um nicht zu ersticken; so lange ich rede, bin ich. Das Räsonnieren, eine gehobene Form des wienerischen Nörgelns, als Form der Existenzversicherung. Und gerade an diesem Punkt hakt Peter Handke (*1942) ein, dessen poetische Konzeption sich Punkt für Punkt als Gegenentwurf zu der Bernhards begreifen läßt. Das Spiel vom Fragen oder die Reise ins sonore Land heißt ein Drama von Peter Handke – was für Bernhard das »räsonnieren« ist, das ist für Handke das »resonare«, das Tönen, der Nachhall. Und so läßt sich auch ohne viel Übertreibung die Literatur Handkes aus den letzten Jahren als ein Gegenentwurf zu der Weltsicht lesen, die Bernhard in seinen Texten vermittelt. Für Handke wird das Bild zu einer Leitinstanz. In einer Tagebuchnotiz aus dem Jahre 1987 liest man: »Wie dachte ich heute Nacht in der Schlaflosigkeit? „Gib mir ein Bild, und so wird meine Seele gesund"« Dem steht die Löschung, die Übermalung der Bilder bei Bernhard gegenüber.
Im Jahre 1989 begann Handke mit seiner »Trilogie der Versuche«: Der Versuch über die Müdigkeit (1989); Der Versuch über die Jukebox (1990) und Der Versuch über den geglückten Tag (1991). Auch diese Texte lassen sich als Spiele vom Fragen begreifen, das Einkreisen von Worten durch Bilder, in jedem Falle durch die Kunst der Wahrnehmung. Und bei der Suche nach dem Bild der Müdigkeit fürchtet Handke, daß er plötzlich parteiisch werden könnte, und so unterbricht er sich plötzlich mit einer Frage: Nicht auf so einen Gegensatz kam es mir mit dem Erzählen gerade an, sondern auf das reine Bild; sollte aber, gegen meinen Willen, sich eine Gegensätzlichkeit aufdrängen, so hieße das, es wäre mir kein reines Bild zu erzählen gelungen, und ich muß mich im folgenden noch mehr als bisher hüten, in der Darstellung des Einen dieses stillschweigend gegen ein Anderes auszuspielen – es darzustellen auf Kosten des anderen, wie es das Kennzeichen des Manichäischen – nur das Gute, nur das Böse – ist, welches heutzutage sogar schon im Erzählen vorherrscht, der ursprünglich am meisten von Meinungen freien, weitherzigsten Weise zu reden: Hier erzähle ich euch von den guten Gärtnern, aber nur, um dort um so mehr von den bösen Jägern reden zu können.
Hier liegt eine polemische Anspielung auf Bernhard vor, auf sein Konzept, das der Erzählung das Bild verweigere, indem es die Welt einfach spaltete, in gut und böse. Demgegenüber gilt es den Geist der Erzählung zu beschwören, der die Welt nicht positiv verklärend wiedergäbe, aber sich doch in der Kunst der reinen Anschauung üben würde. Für Handke gilt die Arbeit am Bild, nicht die Trennung in verschiedene Lager; der Text sei von der Meinung zu säubern, es sei ihm der Verdacht, einer Tendenz zu dienen, zu entziehen. Und freilich scheint sich Handke gleich selbst zu widersprechen, aber gerade in der Folge nimmt er den Gestus Thomas Bernhards an, indem er sich mit einer Fluchgebärde gegen Österreich wendet: Das Weltgericht, an das ich einmal, was unser Volk betrifft, tatsächlich einen Moment lang glaubte – ich brauche nicht zu sagen, wann das war – gibt es dem Anschein nach doch nicht; oder anders: die Erkenntnisse solch eines Weltgerichts traten innerhalb der österreichischen Grenzen nicht in Kraft und werden, so mein Denken nach der kurzen Hoffnung, da auch niemals in Kraft treten. Das Weltgericht gibt es nicht. Unser Volk, mußte ich weiter denken, ist das erste unabänderlich verkommene, das erste unverbesserliche, das erste für alle Zukunft zur Sühne unfähige Volk der Geschichte.
Hier spricht Handke im Tonfall des Propheten, der sein Volk züchtigen muß, um es zu retten. Diese Passage erweist sehr schön, wie der Österreich-Diskurs in der Literatur in den von Bernhard vorgegebenen Bahnen verläuft: Handke sucht hier in etwa ein Gegenbild zu entwerfen, die Anspielung auf die zuvor zitierte Partie aus Auslöschung ist natürlich nur denen einsichtig, die über so etwas wie eine Inside-knowledge verfügen, zum anderen wird aber geht es auch darum, die Balance zu wahren, die die Erzählung garantiert. Handkes Theaterstücke enthalten seit Beginn der achtziger Jahre immer wieder solche programmatischen Szenen, in denen sogar Verkündigung riskiert werden. So hält in dem »Dramatischen Gedicht« Über die Dörfer die Figur Nova so etwas wie eine Programmrede über das, was ist und das, was nicht ist, wobei natürlich Parmenides das Leitmuster abgab: Daß das Sein ist und das Nicht-Sein nicht, ist auch hier das Dogma, von dem ausgegangen wird. Nova: »Aber laßt das Gegrübelt über Sein und oder Nicht-Sein: das Sein ist und wird weitergedacht, und das Nicht-Sein ist nicht denkbar – es gibt darüber nur ein Brüten.« Und in der Folge wird die Natur verklärt, und der Text mündet in der Aussage, daß die Natur das »einzig stichhaltige Versprechen sei.« Und für Handke verwandelt sich die Natur auch zu einer Art von Seinsbestätigung; an der Natur ist das abzulesen, was »Sinn« macht, und Handkes Werk dient nun einer Anstrengung: nämlich Sinn und Zusammenhang herzustellen, auch dort herzustellen, wo er so gut wie suspendiert zu sein scheint.
Und dieser Gegensatz zwischen jenen, die verneinen – und Bernhards Werk scheint ja kristallin um dieses »Nein« gebildet zu sein – und jenen, die, wie Handke ein Ja sagen wollen, bestimmt auch dies immer radikaler werdende Bemühung Handkes um die Sprache und um die Erzählung und um die Natur. Handkes Roman Die Wiederholung (1986) schließt mit einem emphatischen Lobgesang auf die Erzählung schlechthin, während Bernhard sein ganzes Leben lang ein »Geschichtenzerstörer« geblieben ist. Handke ist vielmehr aus auf das, was Grillparzer zu Beginn des Armen Spielmanns als die »Sehnsucht nach dem Zusammenhang« bezeichnete. Und dieser Zusammenhang ergibt sich auch aus der Anschauung der Natur; wer in die Natur flieht, flieht in einen geschichtslosen Raum, und schon bei Goethe war dessen Gang in die Natur auch als ein Rückzug aus der Geschichte in Natur aufgefaßt worden. Aber Handke ist klug genug, auch die Gegenposition einzubauen und auch den Gegner mit einer fast freundlichen Zügen auszustatten. Zwei Figuren in seinem Spiel vom Fragen bilden nun so einen Gegensatz, und ihr Gespräch dreht sich um die Natur. Der eine heißt »Mauerschauer«, der andere »Spielverderber«. Dabei ist der Spielverderber stets darauf aus, jede durch das Naturschöne entstandene Wortkaskade der Lächerlichkeit zu überführen, genau so wie Musil seinen Helden Ulrich im Mann ohne Eigenschaften die Naturemphase der Cousine Diotima jedesmal zur Farce degradiert und überdies für ein »Erdensekretariat der Seele und Genauigkeit« eintritt.
Der Spielverderber weiß, was er seinem Ruf schuldig ist, wenn er dem Mauerschauer die Natur, wo er nur kann, madig macht. Aus beiden indes spricht auch die Literatur; beide sind Sprachrohre zweier Stimmen der Weltliteratur, der eine, der Spielverderber, hat Tschechow zum Paten, der andre, der Mauerschauer, Ferdinand Raimund:
SPIELVERDERBER Das ist doch ein vertrockneter Wurm. In der Kindheit für mich ein Beweis, daß es keinen Gott gibt. – Und was ist das? MAUERSCHAUER Schneckenspuren, silbrig. SPIELVERDERBER Todesspuren. –Und was noch? MAUERSCHAUER Eine Vogelfeder, schwarz, mit sechs weißen Punkten, in der Form des Sechs auf einem Würfel. SPIELVERDERBER Und die Feder steckt in einem Kadaver, staubgrau. – Und das ist nun, ich habe mitgezählt, schon das dritte Vogeljunge allein auf diesem Wegstück. Die Augen noch geschlossen, der Körper nackt bis auf diesen Federansatz. – Und das ist auch der Unterschied zwischen uns beiden: Ich sehe zuerst die Zeichen des Unglücks und Unheils, und du siehst nichts als die auf deinem Weg verstreuten schönen Federn. Mauerschauer nach dem Schönen, holst dir früher oder später an Leib und Seele die Niednägel. Du und dein Schönes. Wird man von solcherart Schauen nicht dumm? MAUERSCHAUER Ja. Aber gesund dumm. Entwaffnend dumm. Zwischendurch war ich einmal klug, geradezu krank vor Klugheit und Wissen, aber durch mein Schauen bin ich wieder so dumm, begriffsstutzig und sorglos geworden wie als Kind. Gelingt mir mein Schauen nach dem Schönen, so atme ich neu die Luft des Geburtstags. Die Welt ist in diesem Fall ich. Ist das mit dir denn anders? SPIELVERDERBER Und in dem Augenblick, da du der Kielgischt der Wolken nachschaust, frißt in der Atmosphäre ein Chloratom ein Ozonmolekül auf, wird aus einem anderen Himmel das Passagierflugzeug abgeschossen, verröcheln unter wieder anderm Himmel, bei Ausbleiben des Engels für die Heimbegleitung der Seelen, die Tausende, von denen es in der Todesanzeige zuerst heißt »Heiter entschlafen« und gleich danach »Tief betrauert.« Deine Art Schauen, heißt das nicht Vereinsamung, im Sinne von: Für nichts mehr in Frage kommen? (76-78)
Die unreflektierte Anschauung der Natur macht dumm, und man möchte meinen, daß darin auch so etwas wie ein verstecktes Lob der Torheit zu suchen ist: Die gesunde Dummheit, die sich dem Schauen verdankt; die Torheit, die zurück zur Kindheit führt. Dieser Dialog Mauerschauer-Spielverderber stellt die Positionen Handke versus Bernhard nach. Was der Spielverderber als Euphemismus, ja als Lüge denunziert, wird für den Mauerschauer zum Zeichen der Seinsvergewisserung. Der Spielverderber sagt: »Schaumensch und Schönheit, das große Lügenduett«. Worauf der Mauerschauer nur sagen kann: »Im Gegenteil: Entdecke ich die Schönheit, macht sie mich für den Augenblick wahr.« (78) Und Handke scheint zu wissen, daß diese Rolle die Rolle eines ist, der das Positive behauptet, denn er läßt den Mauerschauer einen Satz einflechten, bezeichnenderweise a parte: »Ich weiß, ich spiele eine undankbare Rolle. Aber einer muß sie ja spielen.« (76) Der Mauerschauer schwärmt vom Baum: »Vor dem Baum: Ganz Auge, ganz Ohr, ganz da – die Ergänzung.« (83) Und dann beginnt der Spielverderber den Mauerschauer zu höhnen: »Wenn ich dieses Wort schon höre: „Baum." „Der Baum des Lebens." „Der Baum der Erkenntnis."« (83) Es beginnt nun ein veritables »Gespräch über Bäume«, und ich müßte mich sehr täuschen, hätte Handke nicht Brechts berühmte Formel darüber im Ohr. Ja, über Bäume läßt sich wieder sprechen; sie sind das Signal, um das die Diskussion sich bilden kann, die Bäume haben ihren Symbolcharakter wieder gewonnen, wieder ist die Rede über Symbole möglich. Der Baum erzeugt das Bild, von dem aus der Naturraum neu geschaffen wird; mit dem Baum identifiziert sich der Mensch neu und sicher. Man halte die Bäume bei Bernhard dagegen; seine Protagonisten sind daheim in den dichten Wäldern, sie studieren Forstwissenschaften, aber in den Bäumen sitzt der Borkenkäfer: Die Natur begeht auf ihre Wiese makabren Selbstmord. Handkes Diskurs über die Natur ist Punkt für Punkt der Widerruf dessen, was Bernhard über seine antagonistische Natur auszusagen weiß. In der Schlußpartie seines Textes Epopöe vom Verschwinden der Wege oder Eine andere Lehre der Sainte Victoire sehen wir Handke wieder auf dem Berg, dem er – dem Muster Cézannes folgend – einen Text gewidmet hatte, um daran sein Einverständnis mit dem Angeschauten, der Natur in eine Folge zu bringen. Die »andere Lehre« muß er nun ziehen, da der Baumbestand auf dem Berg durch einen Brand vernichtet ist:
Die erhabene Sainte Victoire, das Gebirge der Seligpreisungen (aus dem Licht, den Farben und der Stille), zeigte sich von dem Feuer entzaubert, gleichsam entkleidet und bis auf den letzten Farbenschleier ausgezogen; »entblättert"; der Lächerlichkeit preisgegeben, mitsamt den Myriaden der verkohlten, hasengestaltigen Stümpfe zu seinen Füßen. Und das würde so bleiben auf unabsehbare Zeit; in diesem Kontinent würde für Generationen von Betrachtern der Anblick der Nacktheit und der Asche vorherrschen; [...] ein allgemeines Totsein, ohne besonderen Leichnam, weder eines Wildes noch eines Vogels noch eben einer Zikade. [...] Dem durch solche Zerstörtheit Irrenden, Stolpernden und manchmal auch schwindlig Dahintorkelnden wurde dann klar, daß er mit dem Brand der Sainte-Victoire einen Weg verloren hatte; Weg: bis dahin für ihn das einzige Ding von Dauer; [...] Seltsam dabei, daß diese Erkenntnis vom Verschwinden seiner Wege nicht nur begleitet war von Enttäuschung [...] und Angst [...], sondern mit einem Zusatz von Einverständnis.
»Zusatz von Einverständnis« das ist die entscheidende Formel, auf die Handke sich im Angesicht der Katastrophe versteht, im Angesicht der Naturkatastrophe: Hier strahlt dem Mauerschauer keine leuchtende Natur mehr entgegen; die Katastrophe scheint den Anschein der Irreversibilität zu haben, und das, was Dauer verbürgte, der Weg, der bekanntlich das Ziel ist, der Holzweg, um ein wenig Heidegger hereinzulassen, ist verlegt, er führt nirgendwohin. Und doch: Hier fällt dann die Formel vom »Zusatz von Einverständnis«. Auch Zerstörung muß sein, auch dieses Weltfinale muß es geben. Vielleicht ist das nicht das letzte Wort, das Handke zu der Natur zu sagen hat; aber er bietet uns ein Bild von menschenleerer Natur, daß er der Empirie, einer tatsächlichen Katastrophe verdankt, einer Katastrophe, die nun nicht mehr in der Lage ist, das schöne Bild zu rekonstruieren.
Christoph Ransmayr: Die letzte Welt (1988)
Von da ist der Weg zu Ransmayr (1954) nicht mehr weit: Sein erstes Buch führte ihn an die Randzonen der Welt im Norden – Die Schrecken des Eises und der Finsternis (1984) – ein Buch über die Polarexpedition von Payr und Weyprecht, freilich mit entschiedenen Fiktionsbrüchen, mit Verflechtung einer Gegenwarts- und Vergangenheitshandlung. Der Gang in eine Randzone, in einen menschenleeren Bereich entspricht den Visionen Bernhards und der Beschreibung Handkes von der von Lebendigem entblößten Sainte Victoire. Die Geschichte, um die es in Ransmayrs Roman Die letzte Welt geht, ist bekannt: Cotta, ein Freund des Dichters Ovid, forscht nach diesem in dessen Verbannungsort Tomi. Die Lesart, Ovid hätte die Metamorphosen vernichtet, wird suggeriert, und so findet Cotta eben dort nicht die Metamorphosen, sondern tatsächlich deren Personal vor, freilich in moderner Redaktion: Ransmayrs Die letzte Welt übernimmt von den Metamorphosen nicht nur das Personal, dessen Schicksal in Variation wiedergegeben wird, sondern vor allem das Prinzip der Metamorphose, der Verwandlung. Cotta wird »die federleichte Bauweise der Welt bewußt, die Anfälligkeit der zu Sand verfliegenden Gebirge, die Flüchtigkeit der Meere, die zu Wolkenspiralen verdampften und das Strohfeuer der Sterne….« Und er fährt mit einem Zitat aus Ovid fort: »Keinem bleibt seine Gestalt« – ein Zitat aus Ovids Metamorphosen. Es gibt überdies noch einen komplexen Zusammenhang mit Ovids gewaltigem Werk und Ransmayrs Buch: Erzählt Ovid in seinem Werk die Geschichte der Welt von der Schöpfung an bis zur Herrschaft des Augustus, so setzt Ransmayr die Geschichte fort, in dem er von der Zeit Augustus bis zum Ende der Welt erzählt, denn Cotta erlebt in der Stadt Trachila, wie die Welt zu Stein wird, wie sich allmählich alles in Stein verwandelt, wie die Moränen die Stadt bedecken. Wo Ovid lebte, in der Bergstadt Trachila, ist alles unter Steinen: »Trachila lag unter Steinen: In jener wüsten Abgeschiedenheit, in die sich Roms Dichter vor der Feindseligkeit der eisernen Stadt geflüchtet hatte, konnten selbst Ruinen nicht bestehen.« (235) Und dem steht in Tomi, der Stadt am Meer, eine üppig wuchernde Natur gegenüber, die durch Überproduktion ebenso vernichtend wirkt:
Die Zeit der Menschen schien in diesem Regen stillzustehen, die Zeit der Pflanzen zu fliegen. Die Luft war so warm und schwer, daß noch in den dünnsten Krumen und Nährböden Sporen keimten, Samen aufsprangen und namenlose Sprößlinge ihre Blätter entrollten. [...] Unter den Umarmungen der Zweige war schließlich nicht mehr zu erkennen, ob ein Wetterhahn oder eine Giebelfigur noch an ihrem Platz stand oder längst zerfallen war. Das wuchernde Grün ahmte die Formen, die es umfing, anfänglich spielerisch und wie zum Spott nach, wuchs dann aber nur noch seinen eigenen Gesetzen von Form und Schönheit gehorchend weiter und unnachgiebig über alle Zeichen menschlicher Kunstfertigkeit hinweg. (270f.)
Die organische wie die anorganische Natur überwältigt alles, was die Menschen an Spur hinterlassen konnten. Naso hat die Geschichten zu Ende erzählt; und so hat uns Ransmayr gesagt, daß eben alles zu Ende erzählt ist. Wer in dieser letzten Welt angekommen ist, der ist auch mit den Geschichten an einem Ende angekommen:
Und Naso hatte schließlich seine Welt von den Menschen und ihren Ordnungen befreit, indem er jede Geschichte bis an ihr Ende erzählte. Dann war er wohl auch selbst eingetreten in das menschenleere Bild, kollerte als unverwundbarer Kiesel die Halden hinab, strich als Kormoran über die Schaumkronen der Brandung oder hockte als triumphierendes Purpurmoos auf dem letzten, verschwindenden Mauerrest einer Stadt. (287)
Das ist das Ende der Welt in einer menschenleeren Steinwüste, und diese Gegenkosmogonie mündet folgerichtig in den Verlust der schriftlichen Überlieferung: »Die Erfindung der Wirklichkeit bedurfte auch keiner Aufzeichnungen mehr.« (287) Vielen ist der Erfolg gerade dieses Buches ein Rätsel geblieben. Es profitiert gewiß von Ovids Metamorphosen, die sich an Intensität der Rezeption nur mit der Bibel messen, ein durchaus angebrachter Vergleich, denn die mittelalterlichen Kommentatoren entschuldigten ihr Interesse an diesen Verwandlunsggeschichten ja gerade damit, daß die Parallelen zur Heiligen Schrift so augenfällig wären. Der »Ovidius moralizatus« war das beste Transportmittel, um verpöntes Sagengut in christlicher Camouflage einzuschmuggeln.
Mit seinem Ovid-Roman hat Ransmayr geschickt den Circulus vitiosus austriazistischer Selbstreferenzen durchbrochen und den Anschluß an Themen und Subthemen gefunden, die sich nicht in Engführung – zumindest ihrer Thematik nach – sofort auf Österreich beziehen ließen. In der Tat enthält das Arrangement durchaus alles, was wir von der Postmoderne erwarten: Es variiert karnevalistisch die Abläufe aus Ovids Metamorphosen, es reichert sie durch ein anachronistisches Verwirrspiel an, es zitiert die verlorene Schrift herbei und handelt vom Ende des Schreibens, es mündet in eine apokalyptische Vision, es tilgt – ganz anders als Ovid dies besorgte – jegliche, vor allem die psychologische Kausalität aus den Verwandlungsgeschichten, es handelt vom Schreiben und vom Schreibenden, vor allem aber vom verlorenen, vom ausgelöschten Werk und es handelt davon, wie der Schreibende seine Spuren tilgt. Die politische Pointe des Buches besteht ja gerade darin, daß ein Dichter, der sich seiner Wirkungslosigkeit bewußt wird, wegen eines Irrtums in vorauseilendem Gehorsam verbannt wird; nicht das, was Ovid zu sagen hat, sorgt für die Vigilanz der Behörden, nicht das, was er an politischer Agitation betreibt, gefährdet seine Existenz, sondern es ist der Apparat, der gegen ihn tätig wird, der ihn ausgliedert, einfach weil er fürchten muß, daß er ein störendes Element sein könnte. So werden Beliebigkeit und Willkür zum Anlaß für die Rolle, die ein Autor zu spielen vermag.
Der Dichter Ovid ist herausgetreten aus seiner Zeitlichkeit, aus der Geschichte. Die Geschichte fällt zurück an die Natur, der Verwandlungsprozeß hat sein Ziel in dieser Letzten Welt erreicht. Der Schluß des Buches spart nicht mit der gepflegten apokalyptischen Vision. Die Geschichte hat ausgedient; die sprachlose Natur erobert sich ihre Rechte zurück, sie siegt gegen den Menschen, der sie vernichtet hat. Von Anfang bis Ende steht der Roman so sehr im Bann der eigenen Kunstfertigkeit, im Bann der eigenen Pose, daß der Gestus der Zitation, respektive der Simulation unbenannt bleibt und das spielerische Eingeständnis ästhetischer Manier nicht mehr erfolgen kann. [...] Im totalitären Naturbild des Verfalls hebt sich die Künstlichkeit des Verfahrens ebenso auf wie die Geschichtlichkeit der Welt. Das gilt gerade auch für das Zauberwort der Schrift. Nachdem diese in naturhafter Präsenz beschworen wird, macht sie gleichfalls eine natürliche Metamorphose durch. Ransmayr hat mit diesem Buch tatsächlich in perfekter Repräsentanz und ohne ironische Distanz die Chiffren herbeizitiert, die nun einmal für unser Verständnis der Postmoderne stehen.
Mag Ransmayr auch mit der Fortschreibung der Metamorphosen Ovids sich tatsächlich aus der austriazistischen Engmaschigkeit befreit haben, so reflektiert sein Text doch so ziemlich alle Motive, die bei Autoren wie Handke und Bernhard prägend waren: Die Natur, die Geschichte aufsaugt; lieber sind die Menschen der Natur den Geschichte verfallen. Eine Natur, die sich selbst zerstört, das verschwundene Werk, die mühsame Rekonstruktion der verlorenen Schrift. Was übrig bleibt, ist ein Petrefakt: »[...] die Gassen waren Hohlwege durch dorniges, blühendes Dickicht und ihre Bewohner in Steine verwandelt oder in Vögel, in Wölfe und leeren Hall.« (286) »Keinem bleibt seine Gestalt« – doch mit dem Ende des Buches wird auch der Vorgang der Metamorphose sistiert. Zuletzt bleibt nur noch der Monolog; Cotta geht ins Gebirge, und er ruft seinen Namen in die tote Natur und ruft »hier!«, »wenn ihn der Widerhall des Schreies erreichte; denn was so gebrochen und so vertraut von den Wänden zurückschlug, war sein eigener Name.« (288) Was übrig bleibt, ist das Echo, eine Metapher für das Verfahren dieser Literatur, die auch nicht mehr sein will denn ihr Echo.
Werner Kofler: Am Schreibtisch (1988)
So ein Werk wie das Ransmayrs verlangt nach einer Replik; und kaum einer ist so sehr zur Simulation des Echos befähigt wie Werner Kofler (*1947). »Er randaliere in den feierlichen Säulenhallen der Postmoderne«, hat Franz Haas in einer pointierten Gesamtdarstellung dieses Autors vermerkt. Sein Text Am Schreibtisch kreist systematisch das Thema Schreiben ein; immer wieder wird Bernhard herbeizitiert, zunächst einmal beim Besteigen eines Berges, in bedrohter Natur, die von den Naturschützern geschützt wird, wo der Schutz und das Gerede vom Naturschutz zugleich abstoßend wirkt. Entscheidend ist, daß Kofler – hierin viel radikaler als Ransmayr – immer auf das kohärente Subjekt verzichtet, ja immer wieder zu Neuanfängen ansetzt, diese Ansätze immer wieder unterbricht, und jedem Leser seiner Bücher müßte somit klar werden, daß seine Texte genauso wenig beginnen wie sie enden. Jeder Erzählanfang bringt eine neue Stimme in den Text, und so entsteht ein polyphones Gewebe; ein Beispiel sei in der Folge zitiert, eine Hommage an Thomas Bernhard, die zugleich aber auch die postmoderne Titelgebung à la Heiner Müller (Treuchtlingen Kalk Auslöschung) parodiert. »Ich reiste nach Deutschland, um etwas zu erleben«, heißt es dann, worauf eine Reihe von Passagen folgt, die die Auseinandersetzung dieses Ichs mit Deutschland zum Thema hat: Ereignislosigkeit allenthalben, und doch ist der Boden durchtränkt von Geschichte. »In Neumünster die Mühlenstraße überquert – kein Schuß aus dem Hinterhalt, nichts.« (50) Und doch: alles scheint irgendwie verborgen, auch wenn es an die fünfzig Jahre her ist. Die Reise durch Deutschland ist natürlich auch eine Reise durch die deutsche Literaturszene, und nun kommen alle dran: Patrick Süskind und Thomas Bernhard, kurzum alles, was erfolgreich ist.
Der Text überspricht in diesem Teil das Gerede, das die Medien machen, sei's von Bernhard, sei's von Süskind, mit seiner Sprache, gleichgültig, ob Printmedien, ob Hörfunk, ob Fernsehen. Die Reise nach Deutschland ist als Motto wie zuvor der Gang oder der Aufstieg in das Gebirge, abrufbar, zitierbar. Und zuletzt wird alles noch in einer Engführung verknüpft: »Ich reiste in die deutsche Geschichte, um etwas zu erleben.« (137) Und nun wird vom Nicht-Aufbewahrenswerten und doch Aufbewahrten, vom Verdrängten und doch stets Präsenten gehandelt, in dem langen Diskurs des Museumsführers: »Vor mir geht der Museumsführer; er hat sich als Stürmer vorgestellt.« (144) Und dieser erzählt nun die Umkehr der Geschichte, und das hat seinen guten Grund darin, daß so etwas wie Geschichte sich machen läßt, daß ihre Spuren wegretouchierbar sind. Und hier, so scheint es mir, legt Kofler Protest ein (144f.). In der allerletzten Verquickung der einzelnen Leitworte, in der letzten raffinierten Engführung ist von »Geschichte als Erlebnisraum« (148) die Rede. Das trifft zum einen parodistisch die, die im Museum Geschichte neutralisieren, zum anderen wird da auch bewußt die Trennung von Natur und Geschichte aufgehoben. Die Natur läßt sich ohne Geschichte nicht mehr wahrnehmen, die Geschichte nicht ohne Natur. Die Natur ist keine Ausrede, sie ist kein Versprechen (Handke), sie ist keine Zuflucht, sie ist kein Geschichtsersatz. Geschichte ist in die Natur eingegangen, sie ist omnipräsent, und der Blick auf die Natur ist der Blick auf die Geschichte, wie der Blick auf die Natur der Blick auf die Geschichte ist. Die kritische Pointe dieses Textes richtet sich gegen die Mode, Geschichte museal simulieren zu können, gegen Geschichte in der Simulation statt in der Reflexion.
Der Erzähler droht die sinnigen Installationen dieses Museums zu zerstören; wir sind auf dem Berg, von dem wir eingangs heruntergefallen sind. Es ist, als hätte es die Mühen der Ebene nie gegeben. Wir sind wieder im »Erlebnisraum der Geschichte«, und der Redende moniert: »Mit der Natur treibt man nicht ungestraft Spott!« »Mit der Geschichte auch nicht«, repliziert der Kustos. (156)
Die Anordnung der Sequenzen ist keineswegs beliebig; Geschichte als Material ist nicht neutral, auch die Beachtung der Natur kann nicht neutral betrieben werden. Anders als bei Ransmayr verschwindet hier die Natur nicht in die Geschichte, sondern umgekehrt: Die Natur wird aus der Geschichte heraus neu erfahren. Kofler erliegt somit nicht dem von Elfriede Jelinek gebrandmarkten Verhalten: »die alte müstifikation: natur statt geschichte« – und überdies könnte die Gegenposition zu Handkes Naturemphase nicht deutlicher kenntlich gemacht werden. Das Subversive enthüllt sich aber unter dem Schein der Beliebigkeit; damit ist auch das Verfahren für die andren Bücher vorgegeben; was sich zuvor nebenbei als »assoziatives Delirium« (so ein ironisches Zitat einer Stimme gegen Koflers Text) gebärdet hat, erweist sich sehr wohl als ein Vorgang, in dem Dinge mit Kalkül verknüpft werden, die voneinander getrennt wahrgenommen wurden. Was sich als Beziehungswahn geriert, enthüllt sich im Fortschreiten des Textes als Beziehungssinn. Wo kein Zusammenhang zu bestehen schien, erweist er sich nun als herstellbar, und scheint sich von Phase zu Phase zu verdichten.
Die so erzeugte Polyphonie ist der kompositorische Trick, um die Disparität der Themen in den Griff zu bekommen. Die Stimmen werden immer wieder verknüpft, immer wieder getrennt und neu verbunden. Es wäre zu wenig, würde man Am Schreibtisch nur als eine raffinierte Einkleidung der in den achtziger Jahren so pompös betriebenen Selbstinszenierung des Schreibens fassen. Gerade indem das Schreiben nicht als der privilegierte Zugang zur Lebenswelt betrachtet wird, indem diese Selbstvergewisserung des Schreibens aufgegeben wird, gewinnt der Text Welthaftigkeit zurück, erhält er seine vitalen Funktionen. Der Schreibende ist nicht mehr der in der Verbannung verschwundene, in der Isolation zu Grunde gehende Autor, sondern ein rabiater Gegner jeder bombastischen Stilisierung des Schriftstellerlebens als Passion.
Werner Kofler: Hotel Mordschein: Mutmaßungen über die Königin der Nacht (1989)
Ganz im Gegenteil – für Kofler sind diese Verfahren gerade ein Mittel, an Geschichte zu erinnern, so auch in der vielleicht stärksten Partie aus seinem Buch Hotel Mordschein: Mutmaßungen über die Königin der Nacht. Die Königin ist in sechs Aufführungen an verschiedenen Bühnen (Prag, Regensburg, Graz, Aachen, Breslau, Salzburg) während der NS-Zeit verschwunden, wobei der Clou dieses Textes wohl darin zu sehen ist, daß dieses Verschwinden sich in der Realität wie auf der Bühne abspielt: Das Bühnenschicksal der Sängerin wird ihr tatsächliches Schicksal. Die Einleitungspartie schildert die Situation in einem KZ, wo die Häftlinge auf teuflische Weise vernichtet werden: Von Hunden in die Flucht gejagt, werden sie erschossen, so als ob sie zu fliehen versucht hätten. Die Schlußpartie wird am Ende wiederholt, mit einem Zusatz: »Und doch, es wäre vielleicht durchzustehen, wenn ich nur eines wüßte: Was geschah mit ihr, der Königin der Nacht?«
Schon der Titel (Mutmaßungen) hat es intertextuell in sich, vor allem aber wird an einer Stelle deutlich, wie sehr sich dies an verschiedenen Texten inspiriert, wie sehr dieser Text sich von anderen nährt: Kafka und Ingeborg Bachmann stehen hier eindeutig erkennbar im Hintergrund; es wird eine poetischen Geographie im Namen Ingeborg Bachmanns konstruiert. Den poetischen Unsinn gegen die Sinnsetzung der Herrschenden zu riskieren, dafür der Staatsgefährdung geziehen zu werden, das gehört zu jenen »Gegenworten«, wie Paul Celan den Ruf der Lucile »Es lebe der König« am Ende von Büchners Dantons Tod bezeichnet hat. Und in der Welt dieser »Gegenworte«, die ernst nimmt, was diejenigen sagen, die von der Gesellschaft als Wahnsinnige ausgegrenzt werden, hat das postmoderne Decorum keinen Platz, wenngleich die Verfahren der üblichen Textherstellung mit kalter Leidenschaft kopiert und dabei widerrufen werden.
Der Ich-Erzähler erscheint nun in verschiedener Gestalt, die Metamorphose wird auch hier zum vorantreibenden Prinzip: »keinem bleibt seine Gestalt« zitiert Kofler plötzlich Ovid und Ransmayr; er gestaltet die Wandlungen, die Metamorphosen des berühmten Plattner-Hofes, wo filmisch die Geschichte nach dem Brand einmal reproduziert werden soll. Wir sind aber auch – wie bereits betont – auf den Büchner-Pfad gesetzt, da gibt es eine Firma Leonce, Lenz und Lena, und wieder werden verschiedene Textanfänge durchgespielt, und die Unzahl der Anfänge enthebt den Schreibenden zugleich der Not des Endens. Dem satirischen Verdikt unterliegt vor allem Ransmayrs Die letzte Welt, und zwar gleich an mehreren Stellen. Das Ich simuliert die Abfassung einer Schrift über die Metamorphosen des Plattnerhofes – damit ist einmal der Hinweis auf Ransmayrs Metamorphosen-Variation gegeben. Die kalkulierte Herstellung eines Werks, das ihm einen »Logenplatz in der Literatur« bescheren würde (dies mit einem Bezug auf eine Rezension zu Ransmayr), ist Objekt der Kritik: Die Literatur, die sich aus der Literatur anderer nährt. Und der Redende selbst parodiert das Verfahren Ransmayrs und zugleich das eigene:
Jetzt hatte ich schon wieder aus der Literaturgeschichte von einem anderen etwas mitgenommen, versehentlich, wie ich später grinsend behaupten sollte, ein Nachbargrab geplündert, mich in einer Nachbar-Grabung der Grabung eines Kollegen bedient! (137) Die Schablonen bleiben vorgegeben: Das Schicksal eines Dichters wie Lenz stellt sich als düstere Prognose ein: »[...] und deshalb bin ich auch hier, wenngleich nur auf der Durchreise nach Moskau, wo man mich in einer Frühlingsnacht tot auf der Straße finden wird.« (156) Kofler hat keine Geschichte zu Ende erzählt; seine Sagen verkümmern wie die von Kafka erzählte Geschichte von Prometheus. Jede Geschichte generiert ihre Variante. So setzt auch der letzet Band dieser Trilogie ein, Der Hirt auf dem Felsen. Das Szenario ist dem Eingang des ersten Teiles nur zu ähnlich, und wieder ist es eine Geschichte, und wieder ereignet sich ein Absturz. Und wieder geht eine Geschichte verloren, sie geht verloren, indem sie berichtet wird. Ein Dozent sei, da ihm ein Professor einen Witz beim Bergsteigen erzählt habe, abgestürzt. Der Vorgang wird in verschiedenen Varianten erzählt, doch es gelingt nicht, ihn zu Ende zu erzählen. Was allerorten so der Brauch ist und im Namen der Rose praktiziert und zelebriert wird – der verlorene Text, das verlorene Lachen, das in seiner Scheinhaftigkeit hergestellte Ganze, das nie begonnene und nie vollendete Werk, der fugenlose Übergang von der Kunstwirklichkeit in die wirkliche Wirklichkeit, und das beziehungsvolle Zitat, die Sehnsucht nach der Natur, die sich der künstlichsten Camouflage bedient, die intime Sachkenntnis im Detail und der verschwenderische Umgang mit Geschichte, das Beharren auf Originalität und der Diebstahl aus der Tradition, die abundante Rede von den literarischen Genres, vom großen Roman über die mörderischen Märchen bis zur perfekt rekonstruierten Kolportage, die Erzählung von den Verbrechen, die erst im Bericht zu solchen werden, der Gang durch die Museen in der Geschichte und in der Natur – all das, was allenthalben ganz und rund ausgekostet wird, hat Kofler nur kurz angerissen. Seine Bücher leben von diesen stofflichen Substraten, die er zugleich, so ein anderer sie gewinnbringend nutzt, vernichtet. Seine Erzählungen nähren sich von dem, was andere schon verarbeitet haben, er ist ein Omnivore, sie zeigen ihn aber immer, als würde er gerade eine Zigarette, an der zuvor gierig gesogen hat, ausdrücken. Er kennt in diesen heiligen Hallen die Rache sehr wohl.
Die hohe Kunst des Zitats in der Letzten Welt
Und die Intertextualität – sie ist doch kein leerer Wahn. Bedient man sich dieses Terminus', so bleibt man nicht angstvoll angewiesen auf das säuberlich herauspräparierbare Zitat, man muß nicht dem Rätselspiel von wem was wann wie und wo gesagt wurde gebannt gehorchen, wenngleich die Texte fast reigenartig miteinander durch Anspielungen verbunden sind; und diese hohe Kunst beherrscht Werner Kofler mit einer Perfektion, die an die Strategie der Zitatverwendung bei Karl Kraus erinnert. Entscheidend bleibt, daß so die unterschiedliche Bewegung innerhalb der Diskurse Natur, Geschichte, Literatur und Sprache erkennbar wird, daß wir in der Lage sind, hier aus der Diskussion fruchtloser Motivvergleiche und Einflußforschung herauszukommen. Mit einem Intertextualitätsbegriff, der sich auf eine Gruppe von Autoren bezieht, läßt sich stringent ein Zusammenhang jenseits waghalsig behaupteter Einflußforschung und jenseits beliebig aufgedeckter Parallelen in motivischer und thematischer Hinsicht entdecken; wohltuend ist die Befreiung von der zwanghaften Suche nach ideellen Querverbindungen. Die Texte antworten aufeinander, sie sind ein oft – wie im Falle Kofler – destruktives, das Vorbild dekomponierendes Echo. Daß die Vision einer Natur grausam zurückschlägt und uns das Szenario einer letzten Welt in unterschiedlicher Stilisierung allenthalben geboten wird, mag als eine Diagnose der Gegenwart auch gelesen werden. Die Unterschiede in der Bebilderung dieses Szenarios wären noch eindringlicher zu beschreiben, daß sie indes vorhanden sind, ist Grund zur Beunruhigung, auch wenn es scheinen mag, daß manche es sich im Hotel am Abgrund sehr behaglich eingerichtet hätten.
Verbindend ist die Suche nach dem rettenden Bild, auch in diesen letzten Welten; Handke will – die Worte wurden bereits zitiert – ein Bild und meint – mit biblischer Anspielung: »Wie dachte ich heute Nacht in der Schlaflosigkeit? Gib mir ein Bild, und so wird meine Seele gesund.« Ganz anders Ernst Jandl; sein Gedicht Das schöne Bild verweist darauf daß dessen Rekonstruktion und Restitution unmöglich ist, solange der unvollkommene Mensch in dieser Welt anwesend ist.
- spar aus dem schönen bild den menschen aus
- damit die tränen du, die jeder mensch verlangt,
- aussparen kannst; spar jede spur von menschen aus:
- kein weg erinnere an festen gang, kein feld an brot
- kein wald an haus und schrank, kein stein an wand
- an schwimmer, boote, ruder, segel, seefahrt
- kein fels an kletternde, kein wölkchen
- an gegen wetter kämpfende, kein himmelsstück
- an aufblick, flugzeug, raumschiff – nichts
- erinnere an etwas; außer weiß an weiß
- schwarz an schwarz, rot an rot, gerade an gerade
- rund an rund;
- so wird meine seele gesund.
Im Bibel-Zitat wird, wenngleich in schmerzhaft ironisch und gebrochen doch der Wunsch aufbewahrt, in einer Welt jenseits des Menschen zu genesen.
Neue Sicht auf die österreichische Geschichte
Robert Schindel: Gott schütz uns vor den guten Menschen – Jüdisches Gedächtnis – Auskunftsbüro der Angst (1995)
Schindel (*1944) überlebte als Kind jüdischer, nach Auschwitz deportierter Eltern den zweiten Weltkrieg in Wien. Bekannt machte ihn vor allem sein Gebürtig, von dem gleich die Rede sein soll. Zuvor jedoch ein Gedicht aus dem Jahre 1995, aus einer Rede, die Schindel anläßlich der Vorbereitungen zur Buchmesse in Frankfurt am Main hielt. Die Klagenfurter Frühlingsballade erschien in dem Bändchen Gott schütz uns vor den guten Menschen – Jüdisches Gedächtnis – Auskunftsbüro der Angst (1995). Dieser Text bezieht sich auf einen anderen, dessen Kenntnis zum Verständnis Voraussetzung ist, ja mehr noch: Er ist zur Bestimmung der jüdischen Identität, im besonderen der Identität eines österreichischen Kommunisten nach dem Fall der Mauer, nach den Ereignissen des Jahrs 1989 Voraussetzung. All das Vergangene ist der Titel der dreibändigen Autobiographie von Manès Sperber (1905-1984), die in den Jahren von 1974 bis 1977 erschien. Deren erster Band (Die Wasserträger Gottes) handelt von der Kindheit Manés Sperbers im galizischen Schtetl an den Ufern des Pruth. Manès Sperber war vom Osten nach Wien gekommen, wurde zum Schüler Alfred Adlers und später überzeugter Kommunist, wandte sich allerdings vom Kommunismus infolge der Moskauer Schauprozesse ab. Es handelt sich also um einen Renegaten des Stalinismus; ähnlich war auch Robert Schindel in seiner Jugend überzeugte Kommunist (und Anhänger Stalins). In diesem Gedicht wird Gegenwärtiges mit Vergangenem verknüpft – die Situation einer literarischen Veranstaltung in Klagenfurt auf der einen Seite, auf der anderen Seite der Blick zurück in die Geschichte des Judentums, im besonderen die Geschichte der galizischen Juden. Da ist von Kirow die Rede, den Stalin ermorden ließ, von Teruel und Dachau, hier ein stalinistisches, dort ein nationalsozialistisches Straflager. Der Sprechende stürzt in die »Talsohle« seiner »Vorzeit« – also ganz in die Tiefe der Vergangenheit. Die Fiktion der Zeitmaschine bestimmt das Gedicht: Die Zeitreise geht auf Schienen, jedoch es handelt sich um eine »Zeitvertikale«. Das Schreckbild des KZ wird beschworen, und zwar durch die Waggons, die allerdings sind »angefüllt/Mit Gelächter«. Vergangenheit und Gegenwart in dem »kleinen Lokal« in Klagenfurt werden ineinander geblendet: Hier das Lachen, dort der Schrecken. Höchst bezeichnend die Tatsache, daß nach dem »angefüllt« der Zeilenbruch zu finden ist – man rechnet nicht, daß aus den Waggons Lachen ausgeladen wird. Das Gelächter der Gegenwart, an dem der Redende offenbar auch partizipiert, steht in Kontrast zu dem Schrecken der Vergangenheit. Ihm ist bewußt, daß er den Blutgeschmack nicht loswerden kann – »mit dem ewigen Blutschnuller im Mund«. Der Redende steht – das Motiv wird mehrfach wiederholt – zunächst mit dem Rücken zur Vergangenheit, bis ihn jemand – pardon – von hinten »fickt«. Und da wird er, zu Beginn des zweiten Teiles dieses Gedichts (offenkundig vor seinem inneren Auge) der Juden ansichtig, die mit der Zahnbürste in der Leopoldstadt den Gehsteig putzen. Hitler und/oder Stalin sind für die Vergangenheit verantwortlich. Freilich wäre es falsch, hier von einer totalitaristischen Auffassung zu sprechen, derzufolge die Verbrechen von Hitler und Stalin austauschbar wären. Hier geht es um den Betrachter, um das »Milchkind«, das von dem einen wie von dem anderen seiner Unschuld beraubt wurde.
In jedem Falle wird in diesem Gedicht wie nur in wenigen deutlich, wie sehr die Vergangenheit in die Gegenwart hineinragt, ja wie gerade in den neunziger Jahren ein Erkenntnisschub einsetzt: Unversöhnlich mit einer fröhlich gestimmten Gegenwart sind die Verbrechen der Vergangenheit. Läßt sich von dieser Erfahrung aus noch von einer Zukunft sprechen? Ist man nicht durch die Erinnerung an die Vergangenheit gebunden? »Sind uns die Aschenwinde günstig?« wird in der letzten Zeile des Gedichts mit deutlicher Anspielung auf Celans berühmte Todesfuge gefragt. Hinter allem steht das Klischee vom jüdischen Geiger: »Überleben die Violinen?« lautet die bange Frage. In demselben Buch hat Schindel die Rolle der Juden nach dem Holocaust unter der Signatur »Erinnerung und Widerstand« zu fassen gesucht. Hier wird eine neue Definition dessen gesucht, was das Judentum nach dem Holcaust jenseits der zionistischen und/oder religiösen Definition des Judentums bedeuten kann. Judentum als Widerstand, das ist für nichtreligiöse, nichtzionistische Juden ein bewußter, produktiver Akt. Es ist ein Eigensinn, und als solcher vermag er sowohl dem Antisemiten als auch der Assimilation zu widerstehen, indem er seinen eigenen Sinn sowohl identitätstiftend wie als politischen Inhalt ausbildet: Die Tradition der Aufklärung ist auch im Zeitalter der neuen Innerlichkeit, die zugleich eine alte Intoleranz ist, nicht vom Tisch; ganz im Gegenteil. Aber das allein ist wohl noch nichts speziell Jüdisches, sondern, wie ich hoffe, das Lebensinteresse aller Menschen, die für einen bewohnbaren Planeten etwas wagen wollen. Doch dieser Inhalt ist für mich Bestandteil des Zusammenschlusses mit mir selbst – als vertilgtem Vorfahren, als nach vorne gerichtetem Überlebenden meines eigenen Todes. Als solcher Zusammeschluß macht er mein Judentum aus. Damit hat Schindel mit einer Genauigkeit wie kein anderer Autor der Zweiten Republik die Situation der Juden definiert, die sich ihrer Vergangenheit inne werden – so als ob plötzlich ein Gesprächstabu für sie gefallen wäre.
Robert Schindel: Gebürtig (1992)
Einer größeren Öffentlichkeit wurde Schindel allerdings weniger durch seine Gedichte als durch seinen ersten (größeren) Roman unter dem Titel Gebürtig bekannt. Der Klappentext illustriert schon die Thematik. Darin heißt es, daß es im Roman um die »Befangenheiten und Verstrickungen in Scham und Lüge« ginge, die sich immer wieder aufs neue als »gläserne Wand« zwischen die Juden, die den Holocaust überlebten, und den »nachgewachsenen deutsch-österreichischen Nichtjuden schiebt.« Ein heikles Thema, und Schindel war in der österreichischen Literatur der erste, der es angefaßt hat. Schon durch seine Biographie
Wirklich: Seine Eltern, Gerti Schindel und René Hajek, waren österreichische Kommunisten jüdischer Herkunft und waren als elsässischer Fremdarbeiter 1943 nach Österreich eingeschleust worden, um eine Widerstandsgruppe aufzubauen. Die Identität der beiden wurde entdeckt, der Vater wurde 1945 in Dachau ermordet, die Mutter überlebte Ravensbrück und Auschwitz. Schindel, geboren 1944, überlebte dadurch, daß er als Kind (Eltern unbekannt) in einem Wiener Kinderheim der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt untergebracht worden war (sic!). Nach dem Krieg konnte die Mutter den Sohn wieder finden; Schindel war von 1961-1967 Mitglied der Kommunistischen Partei, distanzierte sich allerdings später von deren Orthodoxie und war 1968-1978 – wie viele seiner Generation – in »maoistischen« tätig. Schindel will erzählen, und zwar einen Stoff, aus dem die Romane allesamt seit den Zeiten Balzacs sind: Das unüberschaubare Leben in der Großstadt, das sich dann doch immer wieder als ein beziehungsreiches Ineinander entpuppt, dessen Gravitationsszentrum in Wien das Beisl ist, aus dem auch die Handlung dieses Romans heraus wuchert. Der Hauptheld heißt Danny Demant (Jahrgang 1941); er ist Verlagslektor und hat als solcher das Romanmanuskript eines Bankiers und Autors namens Emanuel Katz zu begutachten. Dieser Roman verfehlt seine Wirkung aber auf eine andere Figur des Romans nicht, und zwar auf Konrad Sachs, der als Sohn des Generalgouverneurs von Polen während der deutschen Besatzung an einem Komplex leidet, den er nur dadurch los wird, indem er aus diesem Komplex einer Artikelserie macht, woraus wiederum ein Bestseller hervorgeht. Dahinter steht auch eine Realfigur, und zwar der Münchner Publizist Niklas Frank, Sohn des »'Königs von Polen'« Hans Frank, der gegen Ende eine ähnliche autobiographische Schrift verfaßte wie Sachs bei Schindel. (vgl. Kaukoreit 1995, 7)
Der Roman ist außerordentlich inhaltsreich, nicht zuletzt deshalb, weil das Manuskript des Emanuel Katz eben dafür sorgt, daß es auch noch einen Roman im Roman gibt. Die Handlungszeit des Romans ist ziemlich genau definiert, und zwar von Weihnachten 1983 bis Februar 1986, und in diesen Text ist noch Katz' Roman eingewebt, wodurch einige Verwirrung entsteht, daß diese Story (Fiktion in der Fiktion) an der Wende von 1980 zu 1981 spielt. Darin wird von einem wackeren ehemaligen Spanienkämpfer berichtet, der einen KZ-Schergen stellt. Die Aufregung kostet ihm aber das Leben, und seine Tochter betreibt mit aller Kraft einen Prozeß gegen den Mann, der seine Identität mit dem gesuchten Oberscharführer leugnet. Sie bewegt einen in New York lebenden Schriftsteller namens Hermann Gebirtig, in dem Prozeß auszusagen. Gebirtig kommt, wird in Wien geehrt, sagt aus. Er hat mittlerweile auch ein Pantscherl mit der edlen Kämpferin begonnen und will nun in Wien bleiben, da aber der Verbrecher freigesprochen wird, wird es ihm zu viel. In dem Roman wird ein Schubkarren von Anekdoten abgeladen, doch nicht genug an dem: Danny Demant hat einen Zwillingsbruder namens Alexander, der uns die Geschichte seines Bruders erzählt. Warum diese Komplikationen nötig sind, wird nicht so recht klar, man kann auf Grund verschiedener Indizien auch zweifeln, ob dieser Alexander (Beiname: »Sascha Grafitto«) wirklich existiert (vgl. Kaukoreit 1995, 6), aber kaum ein Roman kommt ohne das Motiv des Doppelgängers oder Zwillings aus. Er gewinnt allerdings kein Profil, als Gegenfigur zu Danny etwa. Entscheidend ist, daß diese Figuren Kunstfiguren sind: Sie kommen aus der Literatur, denn Danny erzählt, daß einer seiner Onkel in Galizien Regimentsarzt war, der wegen einer Affäre, die seine Frau mit einem anderen Mann, hatte sich duellieren mußte und im Duell starb. Nun wissen wir, daß Schindel keinen geringeren als Joseph Roth weitererzählt, und zwar dessen Radetzkymarsch (1932). Die Stelle ist deswegen auch entscheidend, weil hier die Kluft zu seiner Geliebten, der katholisch erzogenen Ärztin Christiane Kalteisen, deutlich wird. Sie kennt natürlich den Roman nicht, aber sie weiß auch nicht wo Galizien liegt, wo Brest-Litowsk liegt, ein Ort, der für die österreichische Geschichte von zentraler Bedeutung war. Mit anderen Worten: Dieser Danny, der Jude, hat mehr von der überregionalen Identität Österreichs geerbt – er hat die Aktien aus dem habsburgischen Mythos noch bei sich verwahrt –, als die anderen, die lauen österreichischen Christen, die nicht über diese Kenntnis der Vergangenheit verfügen; ihre Identität erschöpft sich im kleinen Alltag der Zweiten Republik und ihrer Provinz.
Man kann an dem Roman und manchem sprachlichen Detail mit gutem Grund herummäkeln – es gibt in der Tat viele Wendungen, wo man nicht weiß, ob die Komik freiwillig oder unfreiwillig ist, wo die Abgründe größer als der Humor sind, doch besonders gelungen und nicht frei von schöner und böser Selbstironie ist der Schluß, in der Juden als Schauspieler und als Überlebende jüdische Schicksale in der Nähe von Osijek darstellen. Da ist eben auch Danny Demant darunter, der seine Erlebnisse in Tagebuchform festhält. Mit diesem Roman hat Schindel nachhaltig auf die Bedeutung der jüdischen Tradition aufmerksam gemacht, vor allem: daß es trotz Holocaust, trotz Exil noch eine jüdische Literatur gibt, die eben im Sinne von Manès Sperber diese »Religion des guten Gedächtnisses« pflegt und damit auch einen Umgang der Menschen pflegt, die nur »von heut'« sein wollen. (Grillparzer: Die Jüdin von Toledo, II, V.490)
Gerhard Roth: Die Geschichte der Dunkelheit (1991)
Die Tendenz zum Zyklischen in der Gegenwartsliteratur ist unverkennbar: Peter Handke hat nach seiner Tetralogie mit den Versuchen über die Müdigkeit, die Jukebox und den geglückten Tag nun auch eine Trilogie vorgelegt; Peter Rosei schrieb ein großes episches Werk nach dem Muster eines Flügelaltars in fünf Teilen und Gerhard Roth (*1942) legt nun einen Roman-zyklus unter dem Titel Die Archive des Schweigens vor; die Reihenfolge innerhalb dieses siebenteiligen Zyklus entspricht nicht der Chronologie der Publikation; das erste Buch in dieser Serie ist der Roman Der Stille Ozean von 1980; darin wird auch für die weiteren Romane Landläufiger Tod, Am Abgrund und Der Untersuchungsrichter das Personal und die Handlung weitgehend vorgegeben. Eröffnet wird der Zyklus mit dem 1990 erschienenen Bildtextband Im tiefen Österreich und abgeschlossen mit dem 1991 publizierten Essayband Eine Reise in das Innere von Wien. Der hier zur Diskussion stehende Band Die Geschichte der Dunkelheit ist laut Information des Verlags als Band sechs des gesamten Zyklus anzusehen. Der innere Zusammenhang der einzelnen Teile ist noch zu klären. Der Ich-Erzähler dieses Romans, der offenkundig mit Gerhard Roth verwechselt werden will, erklärt eingangs: »Von Anfang an hatte ich die Absicht, einen Roman über Österreich zu schreiben, über den offen daliegenden Wahnsinn der österreichischen Geschichte und den versteckten des österreichischen Alltags.« Und Roth fährt fort: »Erst der Selbstmord Aschers brachte mich dazu, meine Arbeit aufzunehmen.« (8) Mit Ascher ist die Hauptfigur des Stillen Ozeans angesprochen; die Grenze zwischen Fiktion und Realität ist somit von Anfang an problematisch. Der Erzähler hat sich, so teilt er zu Beginn mit, der Geschichte des Wiener Judentums gewidmet und 1987 durch die Vermittlung des Verlags den 1919 in Wien geborenen, 1938 aus Österreich emigrierten und 1962 in seine Geburtsstadt zurückgekehrten Juden Karl Berger kennengelernt; dessen Bericht will er nun ohne große Veränderungen in seinen Aufzeichnungen wiedergeben. In diesem Text würden sich »die Grenzen zwischen Dokument und Literatur [...] aufheben.« (10) Karl Berger erzählt sein Leben: Die Kindheit in Wien, die Jugend in der Zeit des Ständestaates, Schulbesuch, die erste Liebesgeschichte mit Lizzy, die zionistisch-sozialistische Jugendorganisation Schomer-Hazair, der Anschluß 1938, die Flucht nach England über die Slowakei, Arbeit auf einem Schiff, eine Reise nach Kanada, Arbeitssuche in England, Dienst in der tschechoslowakischen Armee im Kampf gegen Hitlerdeutschland, Heirat mit einer Engländerin, Geburt einer Tochter, Scheidung, Fahrt nach Israel, Arbeit in einem Kibbuz, Heirat mit einer Deutschen, Geburt von sechs Kindern, fünf Töchtern und einem Sohn, Rückkehr nach Österreich und tätiger Mithilfe des ehemaligen Vizekanzlers Bruno Pittermann, Tod der Frau und Selbstmord 1962 geborenen Sohnes im Alter von vierundzwanzig Jahren. Den Abschluß bildet die Wiederbegegnung mit Lizzy, aber ehe daraus eine echte Story werden konnte, brachte der Erzähler den Bericht zu Papier und dieses in den Verlag und dieser wiederum das Buch heraus. Sympathisch das unprätenziöse des Berichts. Gerhard Roth öffnet tatsächlich ein Archiv, um das Schweigen über die österreichischen Exilanten zu brechen. Besondere Beachtung verdient, daß Roth keinen prominenten Emigranten zu Wort kommen läßt; es ist ein Schicksal, das gerade durch die vermeintliche Alltäglichkeit seine Besonderheit gewinnt, und die generationstypische Weltsicht des Mannes, der manchmal zum Sozialismus inkliniert und Menschen nach ihrer ideologischen und konfessionellen Herkunft taxiert, wird aus seiner Rede- und Denkweise erkennbar.
Mag alles auch ziemlich umständlich klingen und Karl Berger in seinem Bericht Bekanntes und allzu Bekanntes wiederholen – der Erzähler läßt sich redlich auf die Perspektive seines Berichterstatters ein, gibt nichts dazu und beschönigt nichts: Mit diesem Lebenslauf, in dem vieles auch für andere Lebensläufe gilt, ist ein Stück Alltagsgeschichte gerettet und ein authentisches Dokument aufbewahrt, das sonst kaum für archivwürdig angesehen würde. Ob nun Karl Berger nun wirklich so heißt oder nicht, ist gleichgültig. Ich hätte es jedenfalls, wenn es ihn wirklich gibt, korrekt gefunden, wenn seine Name statt oder neben dem Gerhard Roths auf dem Titelblatt zu lesen wäre; hat aber Roth diesen Bericht selbst zusammengestellt und so verfaßt, müßte ihm für die stilistische Mimikri höchstes Lob gezollt werden. Die Authentizitätsfrage wird sich die Roth-Forschung der Zukunft stellen müssen. Daß hier offenkundig schriftliche Aufzeichnungen vorliegen, geht aus einer Fehlleistung und Fehllesung hervor: Karl Berger fährt, so heißt es, von der holländischen Hafenstadt Veissingen nach England. L und E sind einander zu ähnlich, und die zweite Auflage sollte daraus besser Vlissingen machen, denn diesen Ort gibt es wirklich, und zwar nicht nur auf der Landkarte, sondern auch in Freuds Traumdeutung (1900).
Neuorientierung im Roman
Peter Handke: Mein Jahr in der Niemandsbucht (1994)
Es sei ein sehr umfangreiches Manuskript, an die tausend Seiten, er kenne es, sagte im Februar 1994 jemand in Madrid; er wisse den Titel, dürfe ihn aber nicht sagen, so ließ sich ein anderer ein Monat später in Salzburg vernehmen. Das Buch würde sicher erscheinen, aber wann, das wisse man nicht. Ende September hieß es zunächst, doch da kam nichts. Aber es mußte kommen, stand es doch im Suhrkamp-Katalog mit Preis und Titel. Kritiker und Handke-Leser verwandelten sich in eine Adventistengemeinde, die der Erscheinung des Herrn im Buche harrte. Doch dieser Meister des Jüngsten Tages hat seine perfekten Regiekünste erst nach dem Erscheinen des Werks zu voller Virtuosität entfaltet: Dem langsamen Erscheinen antwortete ein schnelles Lesen (?) und ein noch schnelleres Rezensieren. Die Juroren der Bestenliste des Südwestfunks nutzten die ihnen zur Verfügung stehende Frist von zehn Tagen und katapultierten das Buch an die erste Stelle. Die Süddeutsche, das Spektrum der Presse und die Tiefdruckbeilage der FAZ brachten ausgiebige Besprechungen, und andere Blätter folgten schnell. Handke stellte sich den Interviewern, und das Szenario der Epiphanie wurde mit dem etwas traulicheren einer fürstlichen Niederkunft vertauscht: »Im Herbst 1994 hielt Handke sein neues Buch – sein Baby – dann angeblich in Händen. „Mein Verleger sagte mir, ich sei der erste. Er kam und sagte, ich hätte es jetzt einige Zeit für mich allein!"« So ließ sich der Autor in NEWS vernehmen, und das Magazin brachte, wohl um die Parallele Buch und Kind nahezulegen, auch ein Photo von Handkes »Gemahlin«. Der Suhrkamp-Verlag empfiehlt sich als Etablissement für sanfte Geburten. Gewiß, die Literaturkritik soll ein Werk nicht abliegen lassen, bis es den richtigen Hautgout für die Literaturwissenschaft hat; sie darf und muß schnell reagieren. Wie aber muß es um ein Werk selbst und wie erst recht um einen Rezensenten bestellt sein, der Handkes Buch mit dem »Wort eines alten Philosophen«, daß »der Weg das Ziel sei«, in die faulende Marinade einer ontologischen Garküche taucht?
Sein schnelles Entree in den öffentlichen Diskurs verdankt Handkes Mein Jahr in der Niemandsbucht gerade dieser medialen Betriebsamkeit, die dieser Text nachdrücklich als ein Uneigentliches verdammt und dagegen mit dem Pathos der Verlangsamung auf das Lesen, das Schreiben und Erzählen als ein neues, ja geradezu modernes Eigentliches setzt. Dieser Widerspruch wird kaum bemerkt, denn für das Langsame läßt sich Partei nehmen, ohne zu merken, wie schnell man das besorgt. Aber die Betrachtung der Handkeschen Texte sollte sich, auch wenn's schwerfällt, den ideologischen Subkurs- oder Verdammungsritualen entwinden.
Er habe einmal eine Predigt geschrieben, erklärte Handke kurz nach Erscheinen von Mein Jahr in der Niemandsbucht in einem Spiegel-Interview und meinte damit die Verkündigungsrede der Nova in dem Drama Über die Dörfer von 1979. Nun wolle er nicht mehr predigen – kein Dogma, keine Thesen, keine Meinungen, nur um das pure Erzählen ginge es.
In seiner Werkgeschichte gebe es keine Brüche, keine Gegensätze, es handle sich um Stufen einer Entwicklung: So sei er durch die Sprachreflexion in Die Wiederholung (1986) für das Erzählen frei geworden, und als erzählte Welt par excellence, als Märchen – allerdings als »Märchen aus neuen Zeiten« – will auch dieses Buch verstanden werden; eine übrigens ebenso unnötige wie kokette Zuweisung an ein Genre und bestenfalls ein willkommener Anlaß für eine Tiefenbohrung zur Bedeutungsbergung. Der Romanbegriff hätte – stellte man in Rechnung, was mit diesem im 20. Jahrhundert alles etikettiert wurde – auch dieses Buch noch ausgehalten.
Es ist allerdings ein Roman der besonderen Art: »1997« prangt nach dem Motti allein auf einer Seite; wir haben es also mit einer Art Zukunftsroman zu tun, und das sollte bei der Lektüre sehr wohl mitbedacht werden. Von Handlung läßt sich in dem Buch kaum reden: Zwar werden viele Szenen detailgenau geboten, zwar lernt der Leser viele Figuren kennen, aber eine Aktion im engeren Sinne läßt sich nicht herauspräparieren. Der Ich-Erzähler erhält durch seine Biographie, die in kleinen Portionen geliefert wird, zusehends Konturen. Er heißt Gregor Keuschnig (wie der Held in der Erzählung Die Stunde der wahren Empfindung von 1975), ist 1997 nicht ganz 56 Jahre alt, war zunächst Rechtsanwalt, dann Diplomat und lebt nun als freier Schriftsteller in einem Pariser Vorort. Er stammt aus Südkärnten wie auch Filip Kobal, der Erzähler der Wiederholung, der auch in diesem Roman auftritt. Und dann gibt es sieben »Freunde«, von denen biographische Skizzen entworfen werden: Emmanuel der Sänger, Wilhelm der Leser, Francisco der Maler, Helena die Freundin, Guido der Architekt und Zimmermann, Urban der Priester und Valentin der Sohn.
Dem Ich gelten etwa die beiden ersten Fünftel des Ganzen, darauf folgt Die Geschichte meiner Freunde, und wieder zwei Fünftel unter dem Titel Mein Jahr in der Niemandsbucht bilden den Abschluß. Räumliches Zentrum ist der Vorort von Paris (blitzschnell als Handkes Wohnort Chaville identifiziert), und das ist symptomatisch: Alles in diesem Roman wirkt so, als würde es von den Rändern her erzählt. In der Niemandsbucht lebt Gregor Keuschnig, nunmehr allein; seine Lebensgefährtin Ana, die meist »die Katalanin« genannt wird, hat ihn verlassen. Seine Einsamkeit schafft die idealen Voraussetzungen für die Wandlung oder Verwandlung. Keuschnig grübelt über das Schreiben und mehr noch über das Erzählen, und auf dieses läßt sich alles fluchtpunktartig beziehen. Immer wieder wird über die Schrift reflektiert: »Herz der Welt, die Schrift: Geheimnis wie sonst nur das Rad und die Augen der Kinder«, sagt der Leser Wilhelm, der allerdings durch eine kuriose Gewalttat unfähig zum Lesen wird: Er rennt mit einer Eisenstange »auf den an einer Ampel, reihenweise schon, wie vor einer Startlinie, auf das Gas tretenden, einander anhupenden Stamm der Autofahrer los«. Doch der Verlust des Lesens bedeutet auch einen Neugewinn: Wilhelm lernt das Schauen, und »indem er ein Ding anschaute, bis er aufgegangen ins Ding war (...) entwaffnete er, zunächst einmal sich selber und wirkte ansteckend«.
Dies nur als ein Beispiel für Handkes »Erzählen«: kaum ein Bericht dient der Herstellung einer Aktion, ja, es hat den Anschein, als würde diese peinlich gemieden. Gregor Keuschnig distanziert sich von den russischen und amerikanischen Erzählern mit ihrer zupackenden Art: Ihm behagt die Zuspitzung auf Höhepunkte und Pointen nicht. Handke ist in der Erfassung von Epiphaniemomenten, von solchen Anatomien des Augenblicks souverän. Unbestritten ist auch das Niveau der Reflexion über die Schreibarbeit; da bieten sich, gleichgültig wie man zu Handke steht, gut kenntliche Ansatzpunkte für eine Diskussion literaturtheoretischer Fragen, und daraus erklärt sich wohl auch, warum fast jedes Buch Handkes ein echter Germanistenschmaus ist. Immanent ist dem Buch die Diskussion um die Wahl der literarischen Form: Da gleich zu Beginn die Rede von der »Verwandlung« ist, wird Distanz zu Kafkas »Alt-Prager Groteske« hergestellt. Die Distanz, die Handke zu Kafka einnimmt, ist auch seinen Journalaufzeichnungen zu entnehmen. Vor allem sein Kafka »dem Schwierigsten beim Schreiben«, nämlich »die Natur in eine Folge bringen«, ausgewichen. Gerade diese Folge, die sich wohl von den üblichen Erzählabläufen unterscheiden soll, gilt es nun durchzusetzen.
Allerdings ist es nicht mehr diese Flucht aus der Geschichte in die Natur, wie sie seit der Tetralogie Langsame Heimkehr in Kombination mit dem Modell der Cézanneschen Naturanschauung bestimmend wurde. Das Jahr in der Niemandsbucht erfährt eine überraschende Ausweitung ins Historische und Politische. Es hat einen Krieg gegeben, einen Bürgerkrieg. (Erinnerlich ist die Äußerung Handkes, mit der er den Deutschen einen Krieg nicht gerade »an den Hals wünschte«, aber doch als Schreckvision deutscher Selbstsicherheit entgegensetzte.) Er habe, so Handke in einem Interview, von diesem Krieg geträumt; im Roman selbst ist der Krieg – er soll von Frühjahr bis zum Sommer 1997 dauern – bereits abgeschlossen, ein ungewöhnlicher Krieg, entstanden durch übergroße Gereiztheit. Die Zeit nach diesem Krieg erscheint als Periode eines hoffnungsvollen Neubeginns. Mir ist bei dieser Kriegsfiktion nicht ganz wohl zumute:
In diesem Herbst rundeten sich und bekamen, sage und schreibe, Farbe selbst die „Äpfel aus deutschen Landen", und als dann, am selben Tag von der Kieler Förde bis hinab ins Saarland, der erste Nachkriegsschnee fiel, gab es eine neue Generation von Kindern welche, anders als die vorigen, angesichts der Flocken beim Aufwachen nicht mehr nur blöd dreinschaute. Das ist, mit Verlaub, geschmacklos, und man wird den Verdacht nicht los, daß hier einer um den ganz kleinen Krieg von innen bittet, um den großen Frieden und das Goldene Zeitalter zu legitimieren. Es scheint als würde der Erzähler versuchen, seine Tagträume vom Krieg mit all den damit verbundenen Allmachts- und Ohnmachtsphantasien so schnell wie möglich unter Kontrolle zu bekommen, um trotz des Ausbruches der Hölle im Nachbarland seine Protokolle behaglich weiterführen zu können: Die plötzlich ausgebrochene Leidenschaft des Pilzesuchens und die unerwartete Rückkehr der Katalanin sind ärgere Bedrohungen des Schreibens als der Blitzkrieg.
Aber das Schreiben trägt den Sieg davon. Ein Anzeichen für die neue Epoche ist, daß ein Kritiker für sein »Bücher-Vernehmen und Ausschnüffeln« keine »Gaffer« mehr findet. (Sag, wer mag der Mann wohl sein?) Und an die Stelle dieses »Buchseibeiuns« kommt Goethe persönlich, »so in Fleisch und Blut, wie nur er das konnte«. Von der Epiphanie der Dinge im Wort kommt Handke zur Wiederkehr der großen Deutschen in der Zukunft: »Eduard Mörike schaffte sich für sein Pfarrhaus einen Anrufbeantworter an«, heißt es. Deutschland, ein Land, das, wie Handke einmal formulierte, im »Abgrund der Geschichte« versunken war, kommt endlich zu sich selbst. In keinem seiner Bücher hat Handke sich so weit auf das historische und politische Terrain vorgewagt. »Herr, gib mir ein Bild, und so wird meine Seele gesund«, hat Handke 1987 notiert, und Gregor Keuschnig weiß: »Meine Schwäche ist, sowohl das Schreckliche als auch das mich an der Geschichte zuweilen Ergreifende, wie die Befreiungstaten und Friedensschlüsse, nicht ins Bild verwandeln zu können.« Bei den Visionen des Goldenen Zeitalters ist er in der Tat bei Vergil und Novalis stehengeblieben, kein schlechter Standard und Ausdruck eines Willens, den Handke bekundete, da er in der Kafka-Preisrede 1979 erklärte, er sei »auf Klassisches, auf Universales« aus. Die Figurendarstellung erinnert gewiß nicht von ungefähr in ihrer beinahe spröden Allegorik an Goethes Willhelm Meisters Wanderjahre. Auftritt, Abgang, Handeln und Befinden der Figuren braucht nicht soziologisch oder psychologisch oder wie auch immer motiviert zu werden. Jede Kausalität, die ein Verhalten plausibel machen könnte, wird kunstvoll hinausgespielt und in den Bereich des Uneigentlichen verbannt. An die Stelle von Ableitung tritt die »momentane Evidenz« (Blumenberg).
Das freilich verträgt sich schlecht mit der epischen Materie, die hier sehr wohl auch »Krieg und Frieden« heißen könnte: Darauf hat sich Handke nun einmal eingelassen und sorgt damit für einen höchst zwiespältigen Eindruck; die Vermutung, daß Keuschnig die Niemandsbucht bezogen hat, weil die Marmorklippen schon vergeben oder unbewohnbar sind, ist so abwegig nicht. Es ist indes unbillig, Handkes Werk in dieser gefährlichen Nähe zu belassen, in die er sich – ich will es hoffen – sehenden Auges begeben hat. Das Buch überzeugt mit den vielen kappen Reflexionen und scharf umrissenen Bildern, es überzeugt mit der Ernsthaftigkeit, mit der ein Autor die Möglichkeiten seines Schreibens (aber nicht des Schreibens schlechthin) auslotet. »Arbeiten als das große Ausruhen!« ist eine paradoxe Devise, die stören könnte, die aber, betrachtet man so manches Amt, unfreiwillig komisch wirkt. Und solche Sentenzen sollen auch provozieren, gehen sie haarscharf an dem vorbei, was der Hausverstand gebietet. Handke will ein Erzählen ohne Katastrophen, ein Erzählen, das, obwohl es Jahrtausende in Gebrauch ist, noch nicht verschlissen ist: Erzählen bedeutet die sublimste und die einzig mögliche Form der Teilnahme am Weltgeschehen. Daher auch die Einsamkeit. Handke ist Wittgenstein treu geblieben; alles wird als Sprachspiel verstanden, und es gilt, mit dem Schreibwerkzeug in der Hand, auf das zu warten, was sich »zeigt«, also auf das Mystische.
Neben Wittgenstein werden auch andere Hausgötter angerufen: Homer, Heraklit, Thukydides, Sallust, Horaz, Wolfram von Eschenbach, Shakespeare, Cervantes, Goethe, Hölderlin, Stifter, Keller, Tschechow, Karl Valentin und Georges Simenon. Das wird die Philologen und die Päda-gogen freuen, denn sie haben endlich wieder einen Zeitgenossen, der ihnen die Tradition glaubhaft nahelegt. Handke betreibt auch kein bloßes Namedropping, er macht mit kundigem Fingerzeig etwas an seinen Kollegen sichtbar, das im Getöse der landläufigen Literaturverwertungsmaschinerie untergegangen ist. Er weiß sein Schreiben präzise und selbstkritisch in diesem weltliterarischen Rahmen zu orten. So läßt er seinen Keuschnig mit dem Gedanken an einen Gesellschaftsroman spielen, nur ist dieser Ort schon von Balzak besetzt. Ein Roman mit dem vielversprechenden Titel Der Apotheker von Erdberg wird ebenfalls geplant, doch würden dessen Gestalten in ein Buch passen, »das schon längst geschrieben ist, nämlich Die Strudelhofstiege«. Am Ende darf Georges Simenon diesen Roman zu Ende schreiben...
Auch wenn die Niemandsbucht das räumliche Zentrum des Buches ist, so werden doch viele andere Schauplätze atmosphärisch evoziert: vor allem Südkärnten, Wien, aber auch Jugoslawien, der Karst, Friaul, Spanien, Griechenland, die Türkei, Schottland, Ägypten, Yucatan, New York, Japan – kurzum, die Niemandsbucht ist der Ort mundialer Nabelschau. Die Welt muß nicht mehr erwandert werden, es genügt dafür der erste Satz der Geschichte. So will dieser Roman ein Sprachereignis sein. Ein Motto stammt aus dem Jakobusbrief: »Werdet aber Schöpfer des Wortes und nicht bloß Hörer!« heißt es; Handke allerdings übersetzt das griechische »poetai« nicht mit »Schöpfer, Erzeuger«, sondern mit »Täter«. Der Autor wäre demnach ein »Worte-Täter«, um nicht zu sagen: »Schreibtischtäter«. Mit dieser Übersetzung schaltet er unnötigerweise das Bedeutungsgebläse ein, und der Leser soll sagen: »Der traut sich was, der Handke!« Und ich glaube, er hat seine Genugtuung daran, wenn ihn so ein »Buchseibeiuns« auf frischer Tat ertappt. PS: Ein zweites Motto hat Handke dem Buch vorangestellt, und zwar aus Horaz, der auch seine Niemandsbucht haben wollte. Der Verlag aber möge im rabiaten Nachdrucken des Buches kurz innehalten, dieses Zitat richtig abschreiben und neu übersetzen lassen. Ein Böser und naturgemäß philiströser Philologe könnte sonst die so schöne Aura des Klassischen zerstören.
Josef Haslinger: Opernball (1995)
Wirkung
Die Fortune von Josef Haslingers (*1955) Roman Opernball ist eng mit aktuellen Ereignissen verbunden, die diesem Buch wenig später folgten und so etwas wie eine Verifikation dessen darzustellen wissen, was in diesem Buch manchem gewiß als übertrieben dargestellt zu sein schien. Hier schien es sich nicht um eine willfährige Nachgestaltung dessen zu handeln, was ohnehin schon durch die Medien zu ahnen war, sondern um eine kühne Antizipation von Ereignissen und Sachverhalten, von Terror und Gefahr, von politischen Konstellationen und Szenarien, die nun, ziemlich genau fünf Jahre nach dem Erscheinen des Buches nichts von ihrer Triftigkeit eingebüßt haben. Dies muß hier mit aller Deutlichkeit festgehalten werden, da damit auch eine Gültigkeit dieses Buches zumindest für die spezifische Situation Österreichs gegeben ist: Dies auch um einem häufig gehörten Einwand gegen Haslingers Buch entgegenzutreten, der eben in dem Buch eine Art geschickt gemachter Kolportageliteratur zu erblicken meint: Für gewöhnlich halten auf die Aktualität berechnete Reißer nicht so lange.
Zu erinnern ist an den schrecklichen Terroranschlag in der Tokioter U-Bahn, der in zahlreichen Punkten, ja, wie mir scheint, bis zum Täterprofil, beklemmende Parallelen zu Haslingers Attentat in der Wiener Opernballnacht aufwies. Darüber hinaus wurde seit 1993 Österreich von rätselhaften Briefbomben- und Bombenanschlägen heimgesucht, die mit der Inhaftierung von Franz Fuchs ihr, wie wir hoffen, nicht nur vorläufiges Ende gefunden hat. Aber auch die mit Franz Fuchs in Verbindung stehenden Fiktionen einer »bajuwarischen Befreiungsarmee« und das Verhalten des Täters sowie seine Vorgangsweise – er kennt sich vorzüglich im Computerwesen aus, ist ein Bastler und jedenfalls in seinem sozialen Umfeld – ein Einzelgänger – sind eine Realität, die die Fiktion von Haslingers Opernball erst einholen mußte: Beim Anschlag in Stinaz gab es zwar »nur« vier Tote – das Zeichen ist aber nicht minder bedrohlich als die fiktive Opernballkatastrophe. Das sind die zwei hevorstechendsten Beispiele, deren erstes Haslinger übrigens auch eine Satire durch Antonio Fian einbrachte, in der der Autor als Verkäufer dargestellt wird, der unmittelbar nach dem Giftgasanschlag in Tokio zwei japanische Touristen davon überzeugen möchte, daß er, selbst wenn sein Buch blitzschnell ins Japanische übersetzt worden wäre, unmöglich der Ideengeber für den Anschlag gewesen sein kann.
Aus diesem Beispiel geht hervor, daß just das, was den Erfolg des Buches bedingte, doch die Leserinteressen einfach ablenkte von der Konzeption dieses Buches und von seiner literarischen Leistung. Ich möchte daher doch auch auf diese hier eingehen, und damit vielleicht auch Haslingers Lesart gegen den eigenen Strich bürsten; ich tue das nicht nur aus Eigensinn (auch der ist in der Literaturbetrachtung ein Desiderat), sondern aus der Überzeugung heraus, daß diese Art von Realismus oder, wenn man so will populärer Unterhaltungsliteratur oder, wie der Klappentext meint, eines mit Spannung und Präzision geschriebenen »Politthrillers« eben auch in ihrer Art der Herstellung überprüfbar sein muß.
Aufbau, Inhalt
So sei es auch erlaubt, die schon mehrfach gerühmte Konstruktion des ganzen Werks kurz zu streifen: Man wird zunächst mit der Rede des neuen Polizeipräsidenten Reso Dorf konfrontiert, der übrigens selbst ein Zuwanderer und serbischer Herkunft ist, ursprünglich Cerne hieß, und, post cladem, mit einer Brutalität sondergleichen die Fremden zu treffen sucht und Verfolgung in einem Jargon androht, der deutlich den Glauben an ein Herrenmenschentum verrät, das seine Deszendenz von der Sprache der Nationalsozialisten nicht verleugnen kann (und will). Die ironische Pointe ist der Kommentar des Herrn Bundespräsidenten, der meint, er selbst würde dies anders ausdrücken, aber grundsätzlich habe der Polizeipräsident recht.
Der erste Satz führt in das Zentralmotiv des Buches ein: »Fred ist tot.« So wird nun die wichtigste Erzählfigur eingeführt, die gleichsam die Untersuchung im eigenen wie im allgemeinen Interesse leitet. Zu jedem Verbrechen gehört die Aufdeckung desselben, und wir werden so in die Perspektive dieser Hauptfigur gleichsam zu Begleitern des Detektivs bei seinen Recherchen. Kurt Fraser, den Vornamen erfahren so richtig erst auf Seite zweihundertsiebenunddreißig, ist ein erfolgreicher Journalist der (fiktiven) Fernsehgesellschaft ETV, einer europäischen Konkurrenzgründung zu CNN, und die Perspektive des recherchierenden Subjekts bestimmt denn auch die Perspektive des Lesers. Wir werden uns allerdings fragen müssen, wie mit dieser Perspektive umzugehen ist, denn, so meine ich, wir dürfen uns von ihr nicht allzusehr vereinnahmen lassen. Aus dieser Perspektive ergibt sich alles weitere: Der Sohn Frasers wurde getötet, dessen Befreiung aus der Drogenabhängigkeit gelang dem Vater erst kurz zuvor. Der Preis für diese Rettung ist aber auch der Tod des Kindes. Diese prekäre Balance von Kindesrettung und Kindestod kennen wir aus Stifters Abdias, wo ja Ditha durch einen Blitz wieder ihr Augenlicht erhält, aber durch dasselbe Naturereignis getötet wird, ein intrikater Schuldzusammenhang, der auch in diesem Text an mehreren Stellen zur Sprache gebracht wird. Durch Frasers Recherchen ergeben sich auch die anderen Berichte: Die Achse ist die Erzählung des Ingenieurs, der an den Taten der »Entschlossenen« wesentlichen Anteil hatte. Ihm ist auch der Schluß gewidmet – ein unheimlicher Showdown in einem Haus auf Mallorca, wo es zu einer Konfrontation zwischen dem letzten Überlebenden der Attentäter und dem Fernsehjournalisten kommt. Von diesem Ingenieur werden zehn Bänder besprochen. Seine ist nach der Frasers die wichtigste Stimme. Dann gibt es den Polizisten Fritz Amon, der auf mehrfache Weise mit den Geschehnissen verbunden ist, nicht zuletzt durch einige makaber-komische Zwischenfälle, Zufälligkeiten, wie sie für einen solchen Roman unentbehrlich sind. Ihm gehören fünf Tonbänder (letztes 263). Erst spät ins Spiel kommen zwei weitere Stimmen, und zwar die des Fabrikanten Richard Schmidleitner (243), dem insgesamt drei Bänder gehören und Claudia Röhler, Tochter eines 83jährigen Mathematikprofessors, der schwerkrank am Opernball teilnimmt, den Ball verläßt, aber beim Verlassen noch Giftgas einatmet, aber gerettet werden kann und in der Folge dann an seinem Leiden stirbt. Claudia Röhler gehören drei Berichte (284). Die Berichte des Industriellen und der Frau Röhler setzen erst da ein, wo die Berichte des Polizisten schon so gut wie vorbei sind. Solches multiperspektivisches Erzählen ist ja nicht völlig neu; ein markantes Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit wäre etwa Christoph Heins Horns Ende (1985), worin es ebenfalls um die Ermittlung eines Täters ging, und zwar aus fünf verschiedenen Perspektiven.
Aber nicht nur das Changieren des Erzählstandpunktes und die somit klug verteilte und auch differenzierende Leistung macht die Leistung dieser Polyphonie aus, wohlgemerkt: Eine sehr distinkte Polyphonie, alle behalten ihre Stimme, ihre sogar meistens durch sprachliche Details gekennzeichnete Stimmen. Bei Jelinek ist das anders: Da geht alles auf in einer fortwährend raunenden, den ganzen Text begleitenden Stimme, die aber in sich unzählige Stimmen vereint. Die Leistung besteht auch darin, den Roman gleichsam zu dezentralisieren. Die verschiedenen Stimmen machen fünf voneinander abgehobene Schicksale (oder mehr) kenntlich. Es entstehen so fünf ineinander verflochtene Kurzromane. Eine der bewährten Methoden, Massenereignisse zu schildern: Die Auflösung in Stimmen. Ganz anders, wie gesagt, die Lösung des Problems etwa bei Elfriede Jelinek oder auch bei Alfred Döblin in Berlin Alexanderplatz: Eine, wenn man so will, technisch konservative Lösung, wobei ich doch daran festhalten möchte, daß es sich dabei um kein wertendes Attribut handelt.
Erzähltheorie: Der neue Realismus
Gerade die so komplexe Anordnung des Erzählinhaltes, die uns noch später beschäftigen wird, macht es notwendig, sich doch auch auf die theoretische Position Haslingers etwas genauer einzulassen, die für die Vorgeschichte und, wie ich meine, auch für eine besonnene Beurteilung dieses Romans erforderlich ist. Wer sich mit dem Befund, hier handle es sich um die österreichische Ausgabe eines Politthrillers abspeisen läßt und dann auch noch alle möglichen Vorteile gegen dieses Genre mobilisiert, liest doch auch an dem vorbei, was die Bedeutung eines solchen Textes ausmacht. Ich will das Werk hier nicht mit formalistischer Engstirnigkeit lesen, sondern vielmehr auf dem Umweg über den Text den Beweis führen, wie dringlich gerade auch die ästhetische Reflexion aus dem Vorfeld für ein Diskussion dieses Romans ist, um auch das, was seine politische und ideologiegeschichtliche Brisanz ausmacht, besser fassen zu können – wie das ja überhaupt in allen Fällen geschehen sollte. Denn daß wir es hier nicht nur mit dem Produkt eines in unseren Breiten schon sehr häufig anzutreffenden Biedersinns zu tun haben und es daher auch abqualifizieren können, scheint mir nicht ganz unwesentlich.
Haslinger hat durch die verschiedenen Etappen seines Schreibens hindurch immer wieder Rechenschaft darüber abgelegt, was seine Auseinandersetzung mit literaturtheoretischen Fragen angeht. Über seine Entwicklung in dieser Hinsicht hat er in seinem Buch Hausdurchsuchung im Elfenbeinturm ausführlich berichtet. So läßt sich auch seine Haltung sehr schön von der anderer Autoren differenzieren. In einer etwas vereinfachten Lesart weist Haslinger auf eine Opposition in der österreichischen Literatur hin, deren eine Seite von den Autonomen, »für die Kant den neuzeitlichen Ahnherren bildete«, deren andere von den »Engagierten, die im mächtigen Schatten von Hegel und Marx standen«, eingenommen wurde.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Fronten immer so einfach verliefen, in jedem Fall war eine ähnliche Frontenbildung erkennbar, die vor allem durch den Glauben an eine mimetische, den Traditionen des Erzählens verpflichtete Literatur auf der einen und an eine nicht mimetische auf der anderen Seite festgelegt wurde. Diese Opposition brach an mehreren Stellen auf: Das Erzählen wurde zum Problem, und Michael Scharang lieferte, wenngleich er es auch ironisch aushöhlte, mit seinem Buch Schluß mit dem Erzählen und andere Erzählungen (1970) ein Stichwort. Thomas Bernhard bezeichnete sich als »Geschichtenzerstörer« und wurde diesem Ruf auch einigermaßen gerecht. Daß diese Position freilich auch viel Anlaß zu radikaler Skepsis gab und die Neo-Avantgarde sich einer intensiven Polemik von Seiten jener ausgesetzt sah, die auch auf dem Weg über die Literatur verändern wollten, ist eine weitere Facette:
Die Avantgarde schien ein zwar interessantes, aber nur innerliterarisch interessantes Experiment zu sein, das in Bezug auf seine Verbindlichkeit auch für weitere Bevölkerungsschichten, die man erreichen wollte, fragwürdig blieb; vor allem würden durch eine solche Praxis nur die Literatur selbst, nicht aber gesellschaftliche Verhältnisse verändert.
Das realistische Erzählen begann somit an Attraktivität zu gewinnen, und wie Haslinger pointiert, und auch wenig selbstkritisch, formuliert: Die aus »der Alternative zur Studentenverbindung zusammengestellten Partisanenverbände« scharten sich um die Zeitschrift Wespennest, die sich in ihrem Untertitel als eine Zeitschrift für brauchbare Texte deklarierte, und sie hätten sich, so Haslinger weiter, aus der »Kriegskasse des 19. Jahrhunderts« finanziert. Auf dieser Generation lastete damals als kaum zu tilgende Hypothek das, was die Debatten um Georg Lukács den Adepten zurückgelassen hatte: Lukács als »Reibebaum«, Brecht als die entscheidende Herausforderung. Daß hier freilich nicht ein neuer Realismus geschaffen wurde und dieser wiederum seine engen Grenzen hatte, hat Haslinger ebenfalls scharf konturiert:
In Wahrheit waren die ästhetischen Konzepte des Realismus in Österreich nicht viel mehr als die zur Norm erhobenen Gesellschaftsdeutungen der autobiographischen Romane einiger Autoren, die aus proletarischem und bäuerlichem Milieu stammten und sich im Zuge der sozialdemokratischen Liberalisierung der Öffentlichkeit Gehör verschaffen konnten. Was sie zu erzählen hatten, klang freilich ganz anders als die Geschichten der Beamtenkinder, die traditionell die österreichische Literatur bevölkert hatten. Daß freilich dieser experimentelle Aufstand nicht ohne Folgen blieb, ist klar: Texte mußten auf andere Weise von ihrer Sprache her überprüfbar sein. Die Wiedergabe der Realität durfte sich nicht auf die Formeln verlassen, die sich so ad absurdum geführt hatten. Daß das Erzählen nicht hintergehbar ist, daß die Literatur in ihrer Gesamtheit auf dieses nicht verzichten könnte, ebenso. In Handkes Werk spiegelt sich dies beispielhaft wider. Hatte er am Anfang sich mit besonderer Verve gegen das Erzählen zu Wehr gesetzt, so versuchte er in einem Buch geradezu beispielhaft die Reflexion auf das Erzählen und dessen Praxis zu verbinden: Die Erzählung vom Tod seiner Mutter erschien 1972 unter dem Titel Wunschloses Unglück und stellte eine sehr bewußte Rückkehr zu den Formel des Erzählens in einer nicht gesuchten, öffentlichen Sprache dar. Dieser Text geht von einer kritischen Sprachreflexion aus, unterwirft sich aber dann nach reichlicher Prüfung des Sprachmaterials doch dem Prinzip der Narrativität. Dieses Buch ist für mich einer der interessantesten Versuche einer Vermittlung, bei der alles andere denn ein fauler Kompromiß herausgekommen ist. Sondern ein gangbarer Weg.
Die österreichische Literatur hatte sich des öfteren dem Vorwurf ausgesetzt gesehen, daß sie zwar formal sauber durchdachte Lösungsvorschläge biete, aber an der gesellschaftlichen Realität vorbeischreibe. In dem immer noch lesenswerten Buch des ostdeutschen Kritikers und Verlagslektors des Hinstorff-Verlages Kurt Batt Revolte intern (1975) wird der westdeutschen Literatur eben vorgeworfen, daß sie lediglich das schreibende Subjekt zum Gegenstand habe und den Kontakt zu einer wie immer gearteten Arbeitswelt verloren habe; Arbeit sei immer nur Arbeit des Schriftstellers, von keiner anderen sei darin die Rede: Wie die entleerte Innerlichkeit würde diese Literatur daher in sich zusammensinken. Daß die Kardinalzeugen für Batt aber Ingeborg Bachmann, Thomas Bernhard, Peter Handke und Oswald Wiener mit seiner Verbesserung von Mitteleuropa hießen und es sich somit vor allem um ein von österreichischen Autoren etabliertes und kritisiertes Phänomen handelte, blieb bei Batt unerwähnt. Was später eben auch als das der Postmoderne ureigenstes Merkmal ausgegeben wurde, nämlich die Darstellung des Schreibprozesses, wird hier also als ein Signum eben der Literatur um 1969 erkannt. Der Literat im Westen sei eben ein der gesamtgesellschaftlichen Praxis entfremdeter Literaturspezialist. Dieser Problemkomplex hat seitdem, so meine ich, nichts von seiner Aktualität verloren. Dahinter steckt freilich eine ganz bestimmte Kunstauffassung: Daß der Schriftsteller mit seiner Literatur etwas zu bieten habe, das eben über die Enklave der Literatur hinaus Verbindlichkeit haben müßte, ist das Postulat. Leider liefert Batt – und bei seiner kritischen Haltung ist das auch schwer – keine Gegenbeispiele, bei denen man auch bleiben möchte.
Dieser geraffte historische Überblick führt nur zum Scheine weg von Josef Haslingers Opernball. Diese Debatte wurde in Österreich ungleich anders geführt als in der Bundesrepublik, nicht zuletzt eben wegen der doch sehr starken und viele prägenden Neoavantgarde der »Wiener Gruppe« und anderen wie Ernst Jandl, Andreas Okopenko und Friederike Mayröcker. Und sowohl durch sein Schreiben wie durch seine persönliche Laufbahn als Generalsekretär der Grazer Autorenversammlung, der 1973 gegründeten progressiven Schriftstellervereinigung ist hier die Stellung eines Josef Haslinger wichtig. Einerseits den Leistungen eben dieser Avantgarde verpflichtet, andererseits aber auch behutsam der Frage nachspürend, wie denn auch die »Alltagsinteressen« in dieser Literatur wirksam zum Ausdruck kommen könnten.
In seinem Essay Hausdurchsuchung im Elfenbeinturm kommt Haslinger nun auch auf die Stellung der sogenannten »Unterhaltungsliteratur« im deutschen Sprachraum zu sprechen. Das alte Lied: die Trennung in eine ernstzunehmende Literatur, die nicht unterhaltend, und in eine unterhaltende Literatur, die nicht ernstzunehmen sei. Bezeichnend, daß Haslinger darin den Umweg über die theoretischen Ansätze des jungen Handke nimmt. In seinen bekannt provokanten frühen Aufsätzen von 1967 unter dem Titel Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms hatte sich Handke, angewidert durch die politischen Slogans der Studentenbewegung, als deren literarischer Exponent er doch zum Teil verstanden wurde, entschieden zu einer Literatur bekannt, die seiner Meinung nach »romantisch« sein müßte: Ich erwarte von der Literatur ein Zerbrechen aller endgültig scheinenden Weltbilder. Und weil ich erkannt habe, daß ich selber mich durch die Literatur ändern könnte, daß ich durch die Literatur erst bewußter leben konnte, bin ich auch überzeugt, durch meine Literatur andere ändern zu können. Und: »Die Wirklichkeit der Literatur hat mich aufmerksam gemacht und kritisch für die wirkliche Wirklichkeit gemacht. Sie hat mich aufgeklärt über mich selber und das, was um mich vorging.« Damit ist für Haslinger Übereinstimmung herstellbar, selbst wenn bei Handke die Praxis mitunter anders aussieht. Doch woran Haslinger Anstoß nimmt, ist Handkes Forderung an sich selbst, daß eine ästhetische Methode nur einmal angewendet werden dürfe und dann schon zu schematisch wäre und der Wirklichkeit nicht gerecht werden könnte. Mit anderen Worten: Das bedeutet die Inthronisation eines Innovationszwanges, und in der Tat haben sich die österreichischen Autoren um 1970 eben sehr unter diesem Imperativ der Erneuerung begriffen.
Für alle schreiben
Gegen diese Praxis legt Haslinger nun denn auch Protest ein. Die Alternativen Formalismus versus (sozialistischem) Realismus scheinen für ihn nicht mehr existent: »Mit dem Verschwinden der Theorie vom sozialistischen Realismus stehen auch ihre Opponenten, die Formeln der Avantgarde, plötzlich wie leere Hülsen im Raum.« Ein Satz, der auf seine Gültigkeit noch zu prüfen wäre, doch das würde hier vorerst zu weit führen. In der Tat, der Streit wirkt etwas abgelebt, wenngleich es die radikale Avantgarde in Österreich nach wie vor gibt, die konsequent auf eine Unversöhnlichkeit in der Theorie und in der Praxis mit bestimmten ästhetischen Methoden setzt und ihrem Ansatz der kritischen Prüfung des Sprachmaterials absolute Priorität vindiziert. Ich denke etwa an Ferdinand Schmatz und Franz-Josef Czernin, für die die Machbarkeit des Gedichtes im Vordergrund gegenüber jeder thematischen Aussage steht, für die Rede über jede Bedeutung die Frage nach dem Wesen von Bedeutungen einschließt. Diese Debatten sind sehr anregend für jeden, der gewillt ist, sich auf Theoretisches einzulassen, und es bedarf dieser Vielfalt auch der Möglichkeiten, einfach zur wechselseitigen Kontrolle. Haslinger hat in seiner Hausdurchsuchung, die wohl in engem Zusammenhang mit dem Roman Opernball zu sehen ist, gegen Handkes Position von früher einiges vorgebracht. Vor allem: Sein Bekenntnis zur Subjektivität befreit ihn aber nicht davon, sich schreibend auf das einzulassen, was er als citoyen wahrnimmt. Das heißt freilich nicht – und damit ist doch eine wesentliche Distanz zu früheren Positionen erreicht, wie sie etwa die in einem engeren Sinne brauchbaren Texte verstanden – daß die politische Situation sich unmittelbar in der Literatur ausdrücken müßte. Die Strategie, die Haslinger empfiehlt, hat etwas Verführerisches an sich: Auf dem Umweg über popularisierbare Literatur doch anders wirksam zu werden als mit der Kopfliteratur. Er verweist auf die Rap-Produktion, die nun – nicht zuletzt auch verbunden mit seinem Namen – in Deutschland und Österreich sich bemerkbar macht.
Auf die erzählende Literatur bezogen bedeutet dies aber auch, daß die Genrefrage doch noch zu diskutieren wäre. In der Literatur ist nichts abgelebt, keine Form überholt oder erledigt. Das Verdikt, etwas dürfe – in bezug auf die literarische Technik – nicht mehr gemacht werden, ist ein Verdikt, das die Ausdruckskraft von Moden mit der Ausdruckskraft von Genres und Stilen verwechselt. In diesem Sinne hat Haslinger 1985 seine Novelle Der Tod des Kleinhäuslers Ignaz Hajek vorgelegt, eine Gattung pflegend, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts schon als abgelebt galt. Restitution und bewußte Herstellung erprobter literarischer Formen müssen nicht notwendig mit der Signatur der Konservativität versehen werden. Vielleicht war es gerade in Österreich dieses Innovationsgebot, das es den Autoren so besonders schwer machte, sich wieder der traditionellen Formen strategisch zu versichern. (Freilich wäre es interessant zu hören, wie heute ein Versepos ankäme oder eine traditionelle Elegie. Gerade Handke hat hier wieder Mut und ein doch auch nicht uninteressantes Gespür für das Gewagte bewiesen, wenn er 1997 mit Zurüstungen für die Unsterblichkeit einfach ein »Königsdrama« sich vorzulegen nicht scheute. Davon wird noch an anderer Stelle zu sprechen sein.)
Die Krise der Literatur und die Antwort der Praxis
So offenbart sich nun dieser Roman als das Resultat einer doch sehr umwegig entfalteten ästhetischen Reflexion und nicht als der Versuch, Erfolgsmodelle, die anderswo sich bewährt hatten einfach abzukupfern. Freilich läßt sich nicht verkennen, daß tatsächlich nicht nur die Amerika-Erfahrungen des Autors für das sachliche Detail Pate standen, sondern auch die amerikanische Literatur, die sich ja derzeit auf dem Buchmarkt in Deutschland einiger Beliebtheit erfreut. Daß Stellungnahmen wie die Uwe Wittstocks und Frank Schirrmachers, die einerseits mehr Unterhaltung und Spannung für den Leser forderten und andererseits die deutsche Literatur der Gegenwart in Bausch und Bogen verwarfen, auch Pate standen, ist ja weiter nicht von Nachteil; man solle es den Kritikern nur zeigen. Was zählt, ist zuletzt das Resultat. Daß die Erzählanlage eben äußerst komplex ist, wurde bereits dargelegt. Nirgends verleugnet der Roman, und das setze ich jenen entgegen, die darin ein »realistisches« Gesellschaftsgemälde sehen wollen, seine Artifizialität. Das bezieht sich nicht auf die einzelnen Übertreibungsformeln oder auf die besonders grausamen Szenen, sondern auf das Arrangement, das durch die Wahl der Perspektive gegeben ist. Dieses erweist sich als ein tragendes Konstruktionsprinzip: Ich meine, daß die Wahl eines solchen Ich-Erzählers meist einen identifikatorischen Effekt involviert. Gerade das scheint mir hier nicht der Fall zu sein. Viel eher soll der Leser auch Distanz zu diesem Kurt Fraser gewinnen, der seine Tätigkeit, den Medien in ihrem Hunger nach möglichst großer Authentizität des Schreckens zu dienen kaum problematisiert, sondern vielmehr stolz darauf ist, an vorderster Front die fürchterlichsten Momente (gerade im Jugoslawienkrieg) möglichst echt und möglichst schnell zu bringen; kurzum: jemand, der sich als Verwalter der medialen Wahrheit – und nur diese gilt – sieht. Ich kenne wenige Texte, in denen die unbarmherzige Tyrannis des Aufschreibesystems Fernsehen so unverhohlen dargestellt wird wie in diesem Roman: Daß etwas ist, wird gleichsam erst durch das Fernsehen bewirkt. Was nicht im Fernsehen ist, existiert nicht.
Die für mich besonders harte Stelle findet sich in einem Bericht aus dem Bosnienkrieg: Fraser hat gefilmt, wie ein Mädchen von einem Soldaten eine Granate in die Hand gedrückt bekommt – und von diesem Gegenstand, den es für ein Spielzeug gehalten haben mag, zerrissen wird: »Nach dem Granatenanschlag auf das Kind war meine Handkamera aber plötzlich mit Gold gefüllt, das ich keinem Risiko aussetzen wollte.« (165) Mit diesen Worten »verrät« sich der erfolgreiche Journalist. Über seiner Fernsehkarriere versündigt sich Kurt Fraser eben auch schon früh an seinem Sohn: Es ist die tragische Paradoxie dieses Textes, daß er just über das Fernsehen und über die Tätigkeit bei diesem wieder zu sich bringen will. Dabei erscheint Fraser in meinen Augen als Täter und als Opfer, als einer, der von den Herren ausgebeutet wird, der aber zugleich durch seinen besonderen Einsatz eben die Macht dieser Herren, der Medien stützt. Ich weiß nicht, ob ich nicht mit dieser Interpretation einer Figur wieder das mir zugemessene analytische Terrain überschreite – denn was tun wir denn, wenn wir über literarische Figuren sprechen? Wir bilden uns ein, wir wären ein Tribunal, das über dies zu befinden hätte, und gerade das halte ich für verwerflich. Zum anderen aber fordert der Roman durch seine fünf perspektivischen Ansätze eben auch dazu heraus, den Figuren in ihren sozialen, politischen, psychischen, moralischen Rahmenbedingungen gerecht zu werden. Die fünf unterschiedlichen Standpunkte sind so gegeneinander zu verrechnen.
Wir sind als Leser dazu angehalten, gleichsam den einen Bericht durch den anderen zu korrigieren. Das kann ich jetzt nicht im einzelnen dartun, in jedem Falle aber ist entscheidend, daß die Taktik und die Ideologie der Terroristen von innen heraus, d.h. durch die Perspektive des Ingenieurs entwickelt wird. Ich meine, daß diese unterschiedliche Positionierung der fünf Perspektiven eben auch dem Leser zumindest eine viel größere Freiheit zur Entscheidung überläßt.
Zugleich hat dieses Buch trotz seines raffinierten Finales aber auch bezeichnende Leerstellen. Eben diesen Umstand halte ich für eine der Stärken dieses Romans. Wir haben es nicht mit einem Buch zu tun, bei dem am Ende alles glatt aufgeht und sich löst. Denn zwar wird die Gruppe der Terroristen in ihrer stupiden und doch gefährlichen Ideologie deutlich dargestellt. Besonders scharfsichtig ist die Analyse der sozialen Elemente, aus denen sich die Gruppe zusammensetzt: Der Geringste (leider erfahren wir nie, warum er so heißt!) ist durch seine Herkunft aus Kremsmünster geprägt: Kremsmünster ist mehr als irgendein Klostergymnasium; diese Schule verkörpert gleichsam die benediktinische Aufklärung, eine Schule, in der es eine Sternwarte gibt, eine große Naturaliensammlung – am meisten von dieser profitiert hat niemand anderer als Adalbert Stifter. Der Geringste wird schon früh in seine Rolle eingeführt; doch ist diese frühe Auserwählung durch den Abt nur den wirren Ideen förderlich. Gerade der historische Galimathias, dessen Verkünder die Figuren werden, ist Zeichen für das merkwürdige Verhältnis der Gegenwart zur Geschichte. Der Geringste beruft sich sogar auf Archivfunde (183), aus denen Anweisungen für das Tausendjährige Reich zu gewinnen wären. Daß der Geringste so mit der Geschichte Österreichs und seiner Erziehung durch die Klosterschule verknüpft wird, stellt noch einmal zumindest in vitro die Erziehung des »österreichischen Katholiken Adolf Hitler« (Heer) nach.
Doch bekommt die Figur auch so etwas wie ein sehr dubiose theologische Tiefendimension: Daß Judas durch seinen Verrat eigentlich das Heilswerk überhaupt erst ermöglicht habe, ist eine in der Theologie häufig lancierte These, die nicht nur scholastischem Tiefsinn entspringt. Das ist es, was der junge Mann von dem Abt in Kremsmünster angeboten bekommt: Freilich wird nicht so recht klar, worauf das hinaus soll – ich halte es in der Handlungslogik für ein blindes Motiv – aber immerhin wird der junge Mann an dieser Stelle eben schon mit solchen verqueren und auch widersinnigen Spekulationen vertraut gemacht. So wird der Gedanke, sich als ein Werkzeug der Heilsgeschichte zu verstehen, ja sich dazu zu machen dem Geringsten schon sehr früh eingebläut (29). Daß er indes mit dem ganzen Mumpiz sein Spiel zu treiben versteht, daß er sich sehr wohl den sektiererischen Praktiken nähern kann, daß er gleichsam Eschatologisches aus dem Stand produzieren kann – all dies wird in dieser Figur in einer kühnen Kombination erkenntlich. Wie auch in Menasses Roman Schubumkehr muß wieder das Waldviertel herhalten, eben dieses Randgebiet, in dem das Verbrechen wie auch der Obskurantismus gedeihen kann: Auch hier ist es die Revitalisierung altertümlicher Kulte, mit denen die Gruppe der Volkstreuen und später die der Entschlossenen fröhliche Urstände feiert. Daß diese Ideologie der Verschwörergruppe sich nicht bilanzieren läßt, ja daß selbst psychologische und soziale Erklärungen nicht greifen, sondern dieser wüste Irrationalismus sich sehr gut mit den technischen Errungenschaften (Internet) anfreunden kann, ist eine außerordentlich zutreffende Beobachtung. Zugleich ist es sehr redlich, daß kein simples Erklärungsmodell angeboten wird, wieso gerade diese Kleinbürger so rasend geworden sind. Im Gegenzug müssen wir uns jedoch fragen, was dieses Überhandnehmen von solchen Symptomen bedeutet, vor allem, wieso sich um solche Irrationalismen immer mehr und mehr Anhänger versammeln. Daß hier ein Vakuum an Geschichtsbewußtsein mit einer Bereitschaft, sich historischen Erklärungen zu verschreiben, zusammentrifft, scheint eine plausible Erklärung dafür zu sein.
Eine andere und meiner Meinung nach wichtigste Leerstelle: Hier eröffnet der Roman in der Tat ein weites Feld für Spekulationen: Selbst diese Terroristen sind nur Spielzeug; denn einerseits scheint ETV, die Fernsehanstalt, sehr wohl Wind davon zu haben, daß es etwas bevorsteht: »Die Frage verfolgt mich: Hat ETV irgendetwas zu mit dem Anschlag zu tun gehabt? Hatte Michel Reboisson einen Hinweis?« (329) Daß die Wiener Polizei etwas mit der Sache zu tun hat, wird vom Geringsten mehrfach betont: Es gibt einen Kontaktmann; möglich aber auch, daß diese den Anschlag nur fördern, um dann als die großen Verhinderer dazustehen. Oder sind sie wirklich die echten Teufel – die Polizei und die Fernsehanstalten? Die das Verbrechen inszenieren, um davon zu profitieren? Gleichsam die mörderische Simulation betreiben: Die ihren Beruf als ein Spiel verstehen, in dem es um so spannender zugeht, je höher der Einsatz ist? Die Wirklichkeit darf für diese Medienwelt nicht für sich bestehen; sie muß ausgewertet werden, sie muß inszeniert werden. Dazu ist jedes Mittel recht, wofern es nur verwendet werden kann. Ebenso ist für die Polizei das ganze nur ein Spiel – immerhin bleibt da einiges offen, und wenn man konsequent weiterdenkt, dann sind die wirren Terroristen gar nicht bösesten, da sie ja nur aus ihrer wie immer veranlagten Blendung heraus handeln. In der Tat sind es Verwaltung und Medien, die mit alledem so spielen, daß ihre Handlungsfreiheit nicht gewährt ist. Die Macht agiert anonym; sie kann sich zurückziehen, sie verfügt über den Apparat, dagegen wirken die kleinen Terroristen geradezu harmlos – obwohl sie diesen schrecklichen Vernichtungsschlag führen.
Krisen des österreichischen Bewußtseins
Der Roman klagt im wesentlichen das falsche Bewußtsein, vor allem das falsche Geschichtsbewußtsein ein: Auch der Fremdenhaß gedeiht gut auf diesem Humus. Auch die eigene, die individuelle Geschichte wird verleugnet – sogar der souverän-rührige alte Mathematikprofessor, um den sich seine Kinder gelegentlich kümmern, hat seine Geschichte, aber er hat so gut wie verdrängt, daß er Nationalsozialist war, hat seinen Kindern nichts davon erzählt, hat Karriere gemacht, weil ein jüdischer Freund von einer Stelle verjagt wurde – all dies entspringt einer unterwickelten Gedächtniskultur und entspringt dem ständigen Begehren mit der Geschichte euphemistisch umzugehen. Als würde man wie Baldriantropfen immer einen Schluck aus dem Fluß Lethe zu sich führen. So kommt auf dem Umweg über die Erzählung zu uns, was der Roman auch als Botschaft tragen mag: Das Vergessen als eine Tugend zu pflegen, um so des Glückes habhaft zu werden. Bedurfte es der Katastrophe, die dieser Giftgasanschlag zur Folge hat? Bedurfte es dieser Knalleffekte, dieser ständig inszenierten Öffentlichkeit? Wird da nicht etwas zu viel auf das Fährschiff geladen, das uns diese Einsichten herüberbringen soll? Bedurfte es des Schlusses, der an eine Räubergeschichte à la Karl May erinnert? Da muß einer Spurenlesen, da gerät einer in Gefangenschaft, da läßt einer sich auch vernehmen – das alles, um das Ende herbeizuführen und in den Besitz der Aussagen des Ingenieurs zu gelangen? Darüber kann man streiten; doch ich meine, daß das Begehren der Leser nach dem Sensationellen eben mehr ist als ein niedriger Instinkt. Wir haben ein Recht auf Schauder und Jammer, wir haben ein Recht auf diesen Heileffekt, den der Bericht von so ungeheuerlichem auslösen mag. In einer berühmten Analyse hat Lukács den Schluß des Michael Kohlhaas getadelt, die Geschichte mit der Zigeunerin und dem Amulett – eine Konzession an die Schauderromantik. Genauso könnte man den Grundeinfall des Romans als eine Konzession an die Kolportage, an die Katastrophenliteratur tadeln. Solche Vorhaltungen gehen an dem Kern der Sache vorbei, meine ich: Nur durch solche oft übertrieben schaurigen Ereignisse, wenngleich in romanhafter Dosierung, kann man einerseits das Interesse wecken, andererseits auch pädagogisch wirken. Die Polizei steht dahinter, ohne sie würde »Harmagedon nicht mehr als ein Wort aus der Apokalypse sein«, meint der Geringste (305).
Der Roman stellt dieses apokalyptische Szenario her – in der perfekten Simulation, die durch die mediale Vermittlung noch verschärft wird. Das Sterben vollzieht sich vor laufender Kamera. Denn daß die Katastrophe jederzeit eintreten könnte, ist schon die Katastrophe: Die Erzählung von der Katastrophe malt daher den Teufel nicht an die Wand, sondern sagt, daß er schon da ist. (Denn auch dies wäre ein möglicher Einwand: Soll man die Terroristen eigens noch auf Möglichkeiten des Terrors aufmerksam machen, soll man sie durch die Lektüre herbeizitieren?) Ich würde in diesem Falle viel eher von einer apotropäischen Wirkung sprechen wollen.
Man könnte dem Text auch eine gewisse Partizipation an dem Leben dieser Gesellschaft, die sich am Opernball begeistert und begeilt, nachsagen, an der Lust, sich im Schatten dieser Prominenz zu sonnen. Doch auch dies verfehlt den Text. Haslinger und Menasse haben ein feines Organ für die Funktion, die der Symbolsprache, vor allem der national wiedererweckten Symbolsprache eignet. Die österreichische Literatur der letzten Jahre hat sich in einer seltsamen Einmütigkeit an jenen Orten niedergelassen, die gleichsam als stabile Zeichen der österreichischen Identität gelten: An der Wiener Ringstraße also. Das Burgtheater hat für alle eine magische Anziehungskraft, für Elfriede Jelinek wie für Thomas Bernhard, für Josef Haslinger wie für Peter Turrini. In dieser durchaus musealen Repräsentanz fühlt man sich geborgen. Aus Burg und Oper hieß ein bekannte Sendung von Heinz Fischer-Karwin, so als ob dort das Wichtigste überhaupt verhandelt würde. Das Kunsthistorische Museum ist nicht ohne Grund der Schauplatz von Bernhards Alte Meister. Die Zeiten, da man sich gegen die Hochkultur verschwor, sind nicht mehr. Nicht daß bejaht würde, was in diesen in Europa in ihrer Pracht einzigartigen Denkmälern konserviert würde, es geht vielmehr darum, sich so der wichtigen Markierungen der österreichischen Geschichte und Mentalität zu versichern. Damit klärt sich auch, für mich zumindest, der Widerspruch, der mich bei der Lektüre dieses Romans am meisten beschäftigte: Warum sucht eine Terroristengruppe ausgerechnet den Opernball aus? Gibt es nicht Ziele, die dem Feindbild besser ins Herz getroffen hätten? Die repräsentative Funktion der Oper und des Opernballs – auch wenn Haslinger sie über Gebühr erhöht – könnte durch wenig egalisiert werden. Das ist der Punkt, an dem Österreich plötzlich sein Haupt erhebt und nicht mehr Provinz ist.
Exkurs: Christoph Ransmayr: Strahlender Untergang (1982)
Christoph Ransmayr ist vor allem durch seine Romane bekannt geworden; aufhellend für das Verständnis seines Gesamtwerkes ist indes auch der 1982 erschienene Text Strahlender Untergang, der ein gigantisches Experiment der Verwandlung der Welt zu einer Wüste nach einem rein geo-metrischen Muster darstellt. Dieser Text enthält bereits die zentralen Themen der Romane Die letzte Welt und Morbus Kitahara: Die Befreiung der Welt von den Zeichen, die wir auf ihr wahrzunehmen gewohnt sind, Herstellung einer »tabula rasa«, auf der das Werk der Moderne (oder, wenn man will, der Postmoderne) entstehen kann.
Das Buch war 1982 erschienen und für 50 Schilling zu haben. Ransmayr war mittlerweile durch Die Schrecken des Eises und der Finsternis (1984) und vor allem durch Die letzte Welt (1988) berühmt geworden. Das Buch ist nun wieder bei S. Fischer zu haben, allerdings im Hochformat (12,5cm mal 21cm) und ohne Photos, in zurückhaltender bibliophiler Ausstattung. Der Text ist so gut wie derselbe, und doch hinterläßt das Buch einen ganz anderen Eindruck: Ransmayr hat kaum etwas geändert, auch wenn das, was verändert wurde, aufschlußreich genug ist. Was sich ursprünglich als Prosa gebärdete, präsentiert sich nun durch den Zeilenfall als Gedicht in freien Rhythmen, und man denkt sofort an das Lehrgedicht der Antike, das dem Transport des Nachdenkens über die Natur diente. In jedem Fall tritt der Text mit einem ganz anderen Anspruch auf. Puchners intensiv-pathetische Farbphotos sollten vermitteln, »was sich mit Worten nicht beschreiben und mit Bildern nicht ausdrücken läßt«. Als Leser ist man in der Neuausgabe auf das pure Wort angewiesen. Dazu paßt auch der vollmundig wirkende zweite Teil des Untertitels der Neuausgabe (Die Entdeckung des Wesentlichen); diese Formulierung findet sich im Text der ersten Fassung und ist in der zweiten an der entsprechenden Stelle gestrichen. Wie soll sich nun diese »Entdeckung des Wesentlichen« vollziehen?
Es ist ein Projekt, das an Jules Vernes Visionen, allerdings auf dem Niveau höchster Abstraktion, erinnert. Eine Wüstenfläche von etwa siebzig Quadratkilometern soll »in eine nahezu geometrische Ebene verwandelt« werden und »Terrarium« heißen; die Zukunft jeder Landschaft sei die Wüste. Das ist ein »Entwurf für eine Welt ohne Menschen« (Peter Rosei), in der jeder menschliche »Proband« einem raschen Untergang ausgesetzt ist. Der »Neuen Wissenschaft« liegt an dem »Wesentlichen«, da sie sich von »Beherrschung und Manipulation« abgewendet habe, es ihr um das »Verschwinden« gehe und »die Zukunft auch der/ belebtesten Landschaft/ Wüste« heißen werde. Eine reflexionsgebremste Apokalypse kündigt sich an; der Mensch ist dem unbarmherzigen Sonnenlicht ausgesetzt, es soll keinen Schatten geben, die Temperatur sinkt nie unter 50° Celsius, doch zuletzt endet alles in der absoluten Kälte.
Ein Text, der nicht erzählt, und doch die Keimzelle zu den großen Erzählungen Christoph Ransmayrs bis zu Morbus Kitahara (1995) zu enthalten scheint. In Strahlender Untergang ist Ransmayr aber ein viel größeres Risiko mit dem Entwurf einer Literatur jenseits des Menschen eingegangen; diesen bleibt in ihrer Nichtigkeit nichts übrig, als im Bewußtsein der Milliarden Jahre, in denen die Sonne leuchtet, die eigene Abschaffung und die Abschaffung des von ihnen Produzierten zu betreiben. Zwar gelangen Ransmayr in diesem frühen Text suggestive Bilder, doch wird, meine ich, in seinen späteren erzählerischen Schriften – vor allem im Finale der Letzten Welt – die Lehre vom Verschwinden viel anschaulicher vermittelt. Ihr scheint vorläufig auch noch das Buch selbst zu widersprechen: Auferstanden aus der Wühlkiste sitzet es nun zur Rechten der Bücher Ransmayrs, zu richten über Verschwinden und Verfall. Davon sind wir noch nicht bedroht, solange der Buchmarkt diese Form des Recyclings pflegt.
Christoph Ransmayr: Der Weg nach Surabaya. Reportagen und kleine Prosa (1997)
Entscheidend aber ist für Ransmayr auch seine Tätigkeit als Essayist, und vor allem als Reiseberichterstatter. So ist sein 1997 unter dem Titel Der Weg nach Surabaya erschienener Band ein deutlicher Beleg für das, was man als Weltläufigkeit oder Globalisierung bezeichnen mag. Reiseberichte sind offenkundig begehrt, und das verwundert, da zur Zeit Weltreisen für viele erschwinglich und selbst ausgefallene Reisezeile sich kaum der Exklusivität mehr erfreuen dürfen. Den Gründen für dieses Phänomen wäre nachzugehen, es wäre zu fragen, warum die Bücher eines Cees Noteboom mit seinem Weg nach Santiago oder die eines Bruce Chatwin über Patagonien und Australien oder Salman Rushdie über Nicaragua oder Redmond O'Hanlons über den Amazonas und Orinoco sowie über Borneo ein Interesse zu wecken vermögen; es gibt keine neuen Welten mehr, die zu beschreiben oder von denen zu erzählen wäre, und schon im neunzehnten Jahrhundert hat Heinrich Heine spitz vermerkt, daß die Langeweile der Lektüre eines italienischen Reiseberichtes nur durch die Verfassung desselben übertroffen werde. Heine meint zwar Bücher über Italien, aber seine Pointe verabschiedet das Genre überhaupt. Es kommt auch gar nicht mehr auf den Gegenstand an, von dem in Reisebericht oder Reportage die Rede ist, sondern auf die Technik, mit der etwas vermittelt wird, und es ist, grob gesprochen, die literarische Qualität, die diese Textsorte bei den genannten Autoren annehmbar macht, und dieses Kriterium der Qualität trifft auf Ransmayrs Texte zu: Es sind kurze, eindringliche Schilderungen von Landschaften und Figuren, dazwischen eingebettet kleine Geschichten; Brotarbeiten könnte man sagen, geschrieben für Merian-Hefte, für Enzensbergers TransAtlantik oder andere Zeitschriften. Der älteste Text ist mit 1979 datiert, der jüngste stammt aus dem Vorjahr. Und es ist sehr viel Österreichisches darunter, so etwa ein Bericht über Kaprun, einer über Polen in Österreich und die Schwarze Muttergottes von Tschenstochau, einer über die Totengräber von Hallstatt und einer – für mich der beste Text des ganzen Bandes – über das niederösterreichische Mostviertel unter dem Titel Die vergorene Heimat. Am meisten Witz finde ich in dem Text über eine Wallfahrt des Adels zur österreichischen Kaiserin Zita, aber gerade da erweist sich die Fairneß und Überlegenheit Ransmayrs: Es wäre nichts leichter, als sich über diese Unternehmung lustig zu machen, aber der Autor vermeidet herablassende Ironie, und gerade dadurch gelingt es ihm, eine scharfe Diagnose auch des Untergangs der Monarchie zu liefern, als deren Kronzeugen er den todkranken Friedrich Heer zitiert. Es geht fast durchwegs um die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, um Reste von Gesellschaftsformen und Bräuchen, von Bewußtseinslagen und Berufspraktiken. Das erfolgt nie mit dem nostalgischen Blick des Brauchtumforschers, sondern mit der spezifisch schriftstellerischen Gabe, historische Befindlichkeiten und Widersprüche ins Bild zu bannen. Die Texte leisten das, was nie durch die Illustration oder durch ein Hörbild herzustellen wäre. So gibt es Photos auch nur zu zwei frühen Texten, bei denen sie unentbehrlich sind. Ransmayrs Sprache ist sonst bildkräftig genug. Viele Texte leben von der Exotik des Nahen, aber sie nähern sich nie dem peinlichen Elends- oder Kuriositätenvoyeurimus. Allenthalben wird die genaue umsichtige Recherche erkennbar, nie aber wird die Mühe selbstgefällig zur Schau gestellt. Mit Ausnahme ganz weniger Texte bringt der Autor sein Ich zum Verschwinden, aber doch entsteht nie der Eindruck von distanzierender Gleichgültigkeit. Schon ganz in der Nähe von Ransmayrs Letzter Welt ist dem Stil und den Motiven nach eine Geschichte von Daedalus und dem Minotaurus. Auch ein Stimmungsbild vom Fall Konstantinopels 1453 findet sich, und da wurde mir, da ich Stefan Zweigs Sternstunden der Menschheit (1927) mit demselben Thema denken mußte, mulmig: Aber auch in diesem Fall hat Ransmayr Takt und Kompetenz bewiesen, indem er ohne Zweigs vom Schicksalspathos aufgeladenen historischen Augenblick auskommt und nüchtern die Situation ins Bild bannt. So ist historisierende Prosa auch heute möglich. Selten habe ich mich in den letzten Jahren durch ein Buch so belehrt und unterhalten gefühlt, und ich wüßte niemanden derzeit im deutschen Sprachraum, der, was Reisebericht und Reportage betrifft, Ransmayr übertreffen würde. Man mag das Ganze als journalistische Brotarbeit bezeichnen, aber die Ernsthaftigkeit eines Autors ermißt sich gerade daran, wenn er dieses glatte Parkett betritt und es mit solchen vermeintlichen Bagatellen sehr genau nimmt.
Christoph Ransmayr: Morbus Kitahara (1995)
Letzte Welten
Christoph Ransmayrs (*1953) Roman Morbus Kitahara erblickte unter falschem Vorzeichen das Licht der Kritik, die auch das Licht der Welt sein will. Die Leserphantasie, die jeden Roman sofort in zeitgeschichtliche Bezüge übersetzt, konnte nicht anders, als das Buch sofort mit Bezug auf den sogenannten Morgenthau-Plan zu setzen. Das hat auch die Rezensenten bestimmt und zu einem mannigfachen Für und Wider herausgefordert. In der Tat, manches läßt den Schluß zu, den Text mit dem sogenannten Morgen-thau-Plan in Verbindung zu bringen, aber wenn man erstens den Roman genau nach seiner literarischen Struktur befragt, die Personenkonstellationen analysiert, die Stilgebung zu beschreiben sucht und sich auf die Erzählperspektiven einläßt und wenn man zweitens weiß, daß der Morgen-thau-Plan zu einem guten Teil eine Erfindung der antiamerikanischen Propaganda war, wird man doch zu einem anderen Ergebnis kommen können (und müssen). Im selben Jahr wie Ransmayrs Roman erschien übrigens das Buch des Hamburgers Historikers und Sozialforschers Bernd Greiner, der die historischen Hintergründe dieser Morgenthau-Legende bloßlegte. Doch ist, auch nach des Autors eigener Aussage, der Morgenthau-Plan durchaus nicht als Impuls für die Fiktion eines nach dem Krieg rückständig gehaltenen Deutschlands und Österreichs zu erblicken, wenngleich natürlich einiges dafür zu sprechen scheint, daß es sich hier um ein Deutschland als Weideland handelt – wie die übliche Lesart dieses Konzepts lautete. Eine Verbindung zu Morgenthau dürfte doch bestehen, da der Mann, der über Moor die Sühnerituale verhängt hat, eben dort geboren sein soll, wo 1967 Henry Morgenthau jr. 1967 gestorben ist. Die Motivation, von Deutschland und Österreich den technischen Fortschritt fernzuhalten, ist jedoch im Morbus Kitahara eine grundlegend andere. Die Werke Christoph Ransmayrs scheinen untereinander zusammenzuhängen. Das Buch, das ihn, zumindest in Österreich, bekannt machte, hat den Titel Die Schrecken des Eises und der Finsternis (1984), worin auf Grund von Dokumenten die österreichische Polarexpedition von Payer & Weyprecht im Jahre 1873 nachgezeichnet wird und überdies aus der Sicht eines Zeitgenossen und Nachfahren dieses Expeditionsteilnehmers auf ein anderen Ebene nachvollzogen wird. Schon in diesem Text durchdringen einander verschiedene Zeitebenen: Die Gegenwart und die Zeit der Expedition. Das Buch, das den Namen Christoph Ransmayrs weit über Österreich hinaus bekannt machte, war – wie bereits erwähnt – sein Roman Die letzte Welt (1988), deren Rezeption nach dem Erscheinen fulminant war. Ransmayrs Buch wurde vom deutschen Feuilleton in die Höhe gelobt und in kürzester Zeit in 22 Sprachen übersetzt. Die Gründe für diesen stupenden Erfolg mögen sehr unterschiedlich gewesen sein. In jedem Fall scheint ein neuer Tonfall in die Literatur eingezogen zu sein, von manchen bewundert, von vielen beargwöhnt, vor allem von denen Vertretern der experimentellen Literatur, von denen, die im Gefolge der Wiener Gruppe die Bildersprache dieser Literatur unerträglich fanden. In der Tat kann man sagen, daß dieses Buch, wäre es zehn Jahre früher erschienen, wegen seines (vermeintlich) neoklassizistischen Gestus aus den heiligen Hallen der Kunst wäre verbannt worden. Das Buch avancierte zum Paradigma der Postmoderne in der deutschsprachigen Literatur, zu einer Variante von Ecos Der Name der Rose, denn schließlich legt sich in beiden der Romantext um eine leere Mitte, um ein verlorenes Werk: Nur ist das zweite Buch der Poetik des Aristoteles wirklich verloren, während die Metamorphosen des Ovid vorhanden sind. Damit erhält der Roman zum Musterbeispiel eines Metatextes: Er parasitiert – und ich verstehe das nicht negativ – auf den Metamorphosen Ovids. Der ursprüngliche Plan war es auch, daß Ransmayr dieses Werk für Hans Magnus Enzensbergers Die andere Bibliothek hätte nacherzählen sollen. Die Unmöglichkeit, dies zu besorgen erzeugte (und so ist auch diese Entstehungsgeschichte dem Grundeinfall des Buches eingeschrieben) den Roman Die letzte Welt. Nimmt man auch Ovids Werk ernst, so läßt sich dessen Inhalt in der Tat nicht angeben. Daß Enzensberger und in der Folge auch Ransmayr auf Ovid gekommen sind, ist alles andere denn ein Zufall. Abgesehen davon, daß kaum ein anderes Werk so in der Kulturgeschichte verankert ist – neben der Bibel – wie dieses und deren erster Stofflieferant ist, so daß Hans Blumenberg mit Grund feststellen konnte, daß die europäische Phantasie ein auf Ovid konzentriertes Beziehungsgeflecht sei, läßt es sich seiner literarischen Form nach schwer oder kaum bestimmen, sondern enthält gleichsam alle möglichen und einander oft widerstreitenden Formelemente: Es ist alles und doch nicht alles: Es ist ein Epos und ein Lehrgedicht, es ist kohärent konzipiert und zerfällt doch in unzählige Teile, es ist ein Schöpfungsbericht und mündet in die reale Geschichte Roms, es ist teleologisch auf die Zeit des Augustus hin konzipiert und läßt doch keinen Plan erkennen, der dies auch durchgehend begründete. Es ist ein unerschöpflicher Steinbruch, der die Fähigkeit des Dichters offenbart, mit allen Formen zu spielen, andere Werke, etwa die Äneis des Vergil in Kurzform herbei zu zitieren, das aber Einschlüsse in novellistischer Kurzform kennt oder sich in der gerafften Darstellung seelischer Vorgänge bewährt. Die Metamorphosen bedienen den Leser auf verschiedenen Ebenen. Es läßt sich in Bezug auf seinen enzyklopädischen Anspruch bestenfalls mit dem Alten und dem Neuen Testament vergleichen. Schließlich ist die gewaltige Wirkung dieses Werkes von diesem selbst nicht mehr zu trennen: Es hat seine Reflexe in der Bildenden Kunst in der Musik, in der Literatur, in der Psychoanalyse und in der Befassung mit der virtual reality: Von dort kommt der Wolfsmensch, Narziß und Pygmalion, lange bevor Goethe seinen Homunculus schuf. Der unausgesetzte Prozeß der Metamorphose führt zur wechselseitigen Erhellung anthropmorpher und theriomorpher Zustände, kurzum: Ransmayr war mit den Metamorphosen Ovids auf eine Goldader gestoßen, und der Verdacht, daß viele der Kritiker von Ransmayr so angetan waren, weil sie keine und nur eine blasse Erinnerung an dieses Werk aus ihrer Schulzeit hatten und sich plötzlich einem faszinierenden Komplex von Motiven gegenübersahen, ist so abwegig nicht. Kein Geringerer als Salman Rushdie hat Ransmayr gelobt und ihn als »a fine novelist« bezeichnet, zugleich aber auch vermerkt, daß er auf den Schultern eines Größeren stünde. Nicht unwesentlich und der Rezeption auch förderlich war es, daß gerade durch diesen kühnen Griff nach den Metamorphosen Ransmayr sich und damit auch die österreichische Literatur aus der Befangenheit in ausschließlich österreichischen Themen befreien konnte. Ransmayr läßt die Figuren in Tomis, dem »Kaff« noch einmal auferstehen, wiederum verwandelt. Cotta, der seinen Freund Ovid sucht, findet ihn nicht mehr. Statt dessen erlebt er, wie die Stadt sich in den Urwald verwandelt, wie das Gebirge mehr und mehr zu Stein wird, wie die Natur menschenleer wird, und zuletzt hört Cotta im Gebirge nur mehr sein Echo. Das grandiose Finale dieses Buches kündigt ein Weltende an. So wie Ovid die Geschichte von den Anfängen bis zur Zeit des Augustus erzählt, so erzählt sie Ransmayr von diesem Punkt an bis zum Ende der Welt, eine Gegenkosmogonie gleichsam. Ich stütze mich im folgenden auf einige Formulierungen von Juliane Vogel, die versucht hat, den Standort dieses Romans in dem großen Forum der Postmoderne zu bestimmen:
So deutet alles darauf hin, daß Ransmayr den Prozeß mythologischer Zivilisation, dem sich die Metamorphosen verdanken, wieder rückgängig macht, daß er das verlorene Buch in eine hypothetische Urschrift zurückübersetzt, deren Archaik auch durch den Kinematographen des Cyparis nicht in Frage gestellt wird. Der Text von Tomi berichtet nur mehr von mythischer Naturverfallenheit. Der Raum der Metamorphosen sowie ihre Gesetze sind die einer undurchschaubaren Natur. [...] Bei der Beschreibung solcher Vorgänge erweist sich Ransmayr noch einmal als Autor der Postmoderne insofern, als er das Weltenende in einer perfekten barocken Simulation inszeniert. [...] Im Prunk katastrophaler Naturbilder fällt Die Letzte Welt in die Geschichtslosigkeit zurück, als wäre Geschichte schon immer Natur gewesen. Alles verkommt im gleichen Erosionsraum der Natur. Auch wenn ich jetzt noch immer über Ransmayrs Die letzte Welt spreche, so bin ich doch schon unmerklich auch bei Morbus Kitahara angelangt: Denn auch hier treten wir in einen – allerdings künstlich hergestellten – geschichtslosen Raum ein. Und der Vergleich, den Juliane Vogel vor dem Erscheinen des Morbus Kitahara mit Thomas Pynchons Gravity's Rainbow angestellt hat, erweist diesem Zusammenhang aufs neue: Die Handlung dieses Romans spannt sich »über die Schlußphase des Zweiten Weltkriegs sowie über das nach Ausnahmegesetzen regierte, unkontrollierbare Nachkriegsdeutschland«. »Nicht minder als bei Ransmayr verdreckt und verrottet hier die Welt. London erweist sich als Ort eines ubiquitären Verfalls. Doch entstammt dieser Dreck nicht aus dem Naturtheater. Er erweist sich als das Mutat jener Zivilisation, die sich im Bombenhagel gerade selbst vernichtet.« Eine weitere Parallele zu Pynchons Roman besteht in der zentralen Funktion der Metamorphose, deren Prinzip er authentischer als Ransmayr erfaßt habe. Ransmayr hält trotz der Verwandlung an den historischen Subjekten fest; Cotta bleibt Cotta, Ovid bleibt Ovid. In seinen Figuren gestaltet er jene vorpsychologische Befindlichkeit, in dem die Grenze zwischen Mensch und Tier noch nicht gezogen ist, eine Bewußtlosigkeit, die die Verwandlung als ein unverstandenes, sprachloses Naturgeschehen erlebt. Die Einwohner der Stadt Tomi sind nie zu dem Bewußtsein erwacht, von der sich Pynchons Protagonisten verabschieden.
Anachronismen
Vieles von dem, was hier mit Bezug auf Die letzte Welt festgestellt wurde, läßt sich auch für Morbus Kitahara festhalten. Doch ergibt sich aus diesem Roman ein Begründungszusammenhang, der vielleicht auch das Urteil über Die letzte Welt zu modifizieren vermag. Auch hier hat Ransmayr ein Buch umgeschrieben, und zwar das Geschichtsbuch. Wir sind nach dem Zweiten Weltkrieg: Wir wissen, wie es da mit Österreich und Deutschland auch weiterging. Ransmayr wählt als Schauplatz die Provinz – man ahnt, daß es eine solche sein muß. Von einer Zentralgewalt ist nicht die Rede, die liegt weit in der Ferne; der moderne Staat mit seiner Verwaltungsstruktur spielt keine Rolle. Es herrscht zwar der undurchschaubare Apparat einer Besatzungsmacht, aber es gibt keine politischen oder historischen Vorgänge, die von außen her Einfluß auf das Geschehen hätten. Erst am Ende, im Tiefland, erfährt Bering von dem Abwurf der Atombombe – zwanzig Jahre nach dem Frieden von Oranienburg: Hier hat Ransmayr die Realgeschichte ganz schön abgeändert. Es wäre irrig anzunehmen, daß Ransmayr ganz konkret die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg angesprochen hätte; es ist die Zeit eines neuen Friedens, eben des Friedens von Oranienburg, und dieser bedingt so etwas wie eine neue Zeitrechnung. Die Besatzungsmacht stammt offenkundig aus Amerika: Elliot und Stellamour. Erkennbar werden die Straflager der Nazizeit – ein Steinbruch. Natürlich dekodieren wir sofort und meinen, dahinter das oberösterreichische Mauthausen zu erkennen. Natürlich meinen wir hinter dem See sofort den Traunsee erkennen zu können, und wenn von der Seepromenade die Rede ist, meinen wir, daß es sich um Gmunden handeln könnte. Einen Kalkgebirgsstock »Steinernes Meer« gibt es schließlich in dieser Gegend ja auch noch. Aber damit hat es sich auch im wesentlichen. Zwar werden Städte wie Wien (113) und Dresden, Nürnberg (399) und Hamburg erwähnt, nie aber kommen sie in den Blick.) Die Anweisungen der Besatzungsmacht sind dunkel: Heuschober statt Bunker [...] Keine Fabriken mehr, keine Turbinen und Eisenbahnen, keine Stahlwerke, Armeen von Hirten und Bauern, Erziehung und Verwandlungen: Aus Kriegstreibern Sautreiber und Spargelstecher! (42) Es gibt Sühnerituale; die Verbrechen werden in der Simulation nachgestellt (45). Doch – und das scheint mir das Entscheidende – diese »Rituale der Erinnerung« greifen nicht. Sie sind für die Hauptfigur des Romans nicht viel mehr als »düsteres Theater« (177). Der Raum um Moor scheint hermetisch abgedichtet. In ihm entwickelt sich ein ganz merkwürdiges Biotop: Dieses wird anhand der Hauptfigur Bering entwickelt. Daß er wie sein Vater der »Schmied« im Dorf ist, ist einer der vielen Archaismen, die diesem Roman das seltsam anachronistische Gepräge geben. Zugleich ist dieser Schmied auch eine Figur, die eine theriomorphe Vergangenheit zu haben scheint: Er hat als Kind eine Vogelstimme, er verliert sie. Ambras wiederum lebt mit seinen Hunden. Die Figuren werden immer wieder in ihrer Kreatürlichkeit erfaßt; sie scheinen der menschlichen Züge verlustig gegangen zu sein. Der Schmied verkörpert ein Moment des – zumindest versuchten – Fortschritt, indem er Ambras' Auto zu einem mythischen Gefährt umformt, dessen »Wagenschläge [...] die Form der eng anliegenden Schwingen eines Vogels im Sturzflug annahmen« und dessen Kühlergrill zwei »zum Fangschlag geöffnete Krallen« darstellen (96). An der Figur dieses Schmieds wird deutlich gemacht, wie in den Menschen der Drang, sich des Fortschritts zu bemächtigen, ungebrochen lebt: Wie die Geschicklichkeit des Bastlers individuell das langsam herstellt, was das Kollektiv viel schneller und wirksamer zu produzieren versteht. Dem Schmied Bering wird nie bewußt, daß er so weit hinter seiner Zeit hinterherhinkt; nirgends dringt eine Nachricht von außen in diese Welt, bis zu der seltsamen Reise in das Tiefland, wo Bering mit dem Fortschritt und einer ganz anderen Zivilisationsstufe konfrontiert wird: Autos! Trucks! Bering hatte noch nie eine solche Zahl von Lastwagen gesehen. Als ob diese schimmernde Reihe von Wagenzügen, Kipplastern und Sattelschleppern allein zu Ehren seiner Ankunft im Tiefland […] aufgestellt worden wäre, ritt er über die Brücke und auf den Fuhrpark zu und widerstand der Versuchung, abzusteigen und Maschine für Maschine zu begutachten. (321f.)
Die Funktion der Anachronismen wird gerade an dieser Stelle deutlich: Erst dieser Hiatus zwischen einer Gegenwart, wie wir sie kennen, und diesem aus einer ganz anderen Wirtschafts- und Sozialform kommenden Menschen klärt uns über den Status unserer Befindlichkeit auf. In nahezu allen Romanen wird ja diese seltsame Rückkehr zu den Naturzuständen beschworen; Ransmayr problematisiert diesen Vorgang eben durch ein Gedankenexperiment, das sich der Historiker nicht, sehr wohl aber der Erzähler erlauben darf: Dieses Experiment macht nämlich sichtbar, wie der Hiatus beschaffen ist, der uns von der Vergangenheit trennt. So bekommen die oft etwas pathetisch wirkenden Bilder auch Funktion, die seltsam archaisierende Sprache die oft glatte Formgebung. Auch das elektrische Licht wird so mit altertümelnder Formelhaftigkeit eingeführt (325).
Anachronismen sollen erkenntnisfördernde Funktion haben: Erst indem wir im Experiment diese seltsame Archaik, die ja auch in unserem Bereich noch nicht so lange zurückliegt, evozieren, wird uns überhaupt klar, welche Veränderungen die letzten Jahrzehnte bestimmt haben. Ransmayr hat dieses Phänomen der Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen vor allem anhand seiner Reisebeschreibungen entwickelt; es geht hier nicht um den schnöden Voyeurimsus, der sich an der Exotik des Nahen und Fernen nicht genug satt sehen kann und weiß, daß er in die Sicherheit seiner fortschrittsgeschützten Privatsphäre zurückkehren kann.
In seinem Film Underground hat der serbische Regisseur Emir Kusturica auch diesem Phänomen des zeitlichen Auseinanderklaffens verschiedener Epochen Rechnung getragen. Er läßt eine Gruppe von Partisanen in einem riesigen unterirdischen Lokal weit über das Kriegsende hinaus leben. Ein schurkischer Partisan verrät nicht, daß sich oben alles geändert hat und befiehlt ihnen auszuharren. Er verbreitet die Nachricht, daß sein Freund im Kampf gefallen sei. Natürlich taucht dieser redliche Kämpfer einmal auf – und er erlebt in der Simulation sein eigens Schicksal von früher noch einmal: Man dreht einen Film und der Aufgetauchte hält den Schauspieler, der einen deutschen Offizier darstellt, für echt und erschießt ihn. Alles ist Simulation, und damit auch eine Kritik am ehemaligen Staat Jugoslawien, der zur Rechtfertigung seiner Existenz eben diese Fiktion des Heldischen benötigte. Ebenso hat Peter Handke in seiner serbischen Reisebuch als Tourist den Zustand als einen nahezu idyllische gepriesen, weil eben dort das Benzin nicht an der Tankstelle, sondern am Straßenrand in Kanistern verkauft würde. Ähnlich scheint auch in der Enklave Ransmayrs noch der Tauschverkehr auf Naturalienbasis zu funktionieren, Lily verlangt Landkarten für einen Smaragd. (149) Der Schwarzmarkt blüht für Zigaretten kann man alles haben. Daß dies alles eben nicht nur Fiktion ist, weiß jeder, der in ein Land der Dritten Welt oder in den ehemaligen Ostblock gereist ist: Verstörend wirkt dieses nebeneinander verschiedener Wirtschafts- und Zivilisationsstufen nur deshalb, weil eben Länder mit heute hohen technologischen und ökonomischen Standards in diesem Zustand gezeigt werden. Insofern wird durch diesen Hiatus weniger ein Deutschland nach dem Morgenthau-Plan charakterisiert, als vielmehr eine in unserer Welt bestehende Kluft beschworen. Daß das Dasein dieser Leute im Moor auch Züge einer modernen Robinsonade, einer Festlandsrobinsonade trägt, sei auch angedeutet: Wie Robinson macht der Schmied Bering aus den Relikten aus den Wracks der Vergangenheit Gegenstände zum Gebrauch. Die Gegenwart lebt von den Trümmern der Vergangenheit; die Isolation ist perfekt.
Sühne
Das Verharren in diesen Zuständen ist allerdings eine Strafe: Die Sieger haben sie verhängt. Genau das, was in den Texten Jelineks, Haslingers, Ransmayrs, Schindels und vor allem Bernhards immer die Kritik an Österreich vorantreibt, gerade das wird im Morbus Kitahara parabolisch als vollzogener Siegerwille gedeutet. Allerdings macht der Autor sich und uns nichts vor: Dies wird nicht akzeptiert; die Bevölkerung bleibt uneinsichtig, dementsprechend ist das ehemalige KZ-Opfer Ambras denn auch isoliert und nicht gelitten: Von Wiedergutmachung keine Rede. Die Kluft zwischen ihm und der Bevölkerung wird immer größer, er, das Opfer, scheint Schuld am beklagenswerten Zustand zu haben. Hier gibt es keine Versöhnung. Ambras ist durch seine Erfahrungen im Lager schwer traumatisiert; da es für ihn keine Kommunikation mit den anderen gibt, isoliert er sich zusehends. Lediglich Bering findet Zugang zu ihm. Mißtrauisch ist die Bevölkerung, da er nun die Insignien der Macht hat. Diesen Sühneritualen entzieht sich Lily: Sie lebt im Gebirge, als Rest des alten Systems, begehrt in gleicher Weise von Ambras wie von Bering. Eine Figur, der keiner sich versichern kann und die sich dem tödlichen Finale entzieht. Dieses seltsame Wesen, Opfer und Täterin zugleich: Aber zweimal, auch dreimal im Jahr, es geschah ohne Regel und Vorhersehbarkeit, verwandelte sich Lily von einem schnellfüßigen, kaum zu erjagenden Opfer in eine ebenso schnelle Jägerin, die stets unsichtbar hoch ob in den Felsen blieb und die ihre Beute noch auf fünfhundert Meter Schußdistanz ins Fadenkreuz bannte und tötete. (125)
Lily verkörpert offenkundig die weibliche Natur, Natur, unvorhersehbar, rächend und grausam – fast möchte man dahinter eines der Klischees vermuten, die sich so gerne einstellen, wenn es um die Rolle der autonomen Frau geht, die dann eben immer mit naturhaften Zügen ausgestattet wird, so als ob der Geist männlich und die Natur weiblich wäre. In jedem Falle scheint mir dieses Sühnemotiv wenig tragfähig zu sein; es wirkt bald abgenutzt, unglaubwürdig – eine sehr deutliche Antwort des Textes auf die Problematik der »Vergangenheitsbewältigung«: Auch der Rückfall in einen Zustand, der sich nicht einmal als eine von agrarischer Kultur bestimmte Zivilisationsform bezeichnen ließe, würde also keine Sinnesänderung bedeuten. Dieser Rückfall hätte auch Reflexionslosigkeit zur Folge; Sühne kann nicht durch Rituale und die szenische Nachstellungen der Opferszenen erfolgen, sondern bedarf eben auch einer reflexiven Ebene, bedarf auch des historischen Verstehens.
Ein Beispiel, das besonders drastisch ist, aber auch vom Scharfblick Ransmayrs zeugt. Der Vater Berings hat den Verstand verloren; er weiß nicht was um ihn herum vorgeht, doch er lebt immer noch im Krieg: Was hier geschieht, markiert drastisch karikierend den Zustand des Bewußtseins der österreichischen Bevölkerung – die ständige Wiederbelebung der Kriegsrituale bei den Veteranentreffen. Die einzige Wirklichkeit, die diesen Gestalten geblieben ist, ist die des Krieges (277, 281, 303). Und was dabei herauskommt ist eine Donquichotterie, der selbst die befreiende Kraft des Komischen fehlt.
Die Figuren verharren aber in historischer Bewußtlosigkeit. Statt der Herausbildung neuer menschenwürdiger Lebensformen entstehen vielmehr unkontrollierbare anarchische Zustände, die einem schrankenlosen Individualismus und der unkontrollierten Gewalt förderlich sind. Auch diejenigen, die die Sühnerituale verlangen, scheinen nicht gewillt, ihren Standpunkt mit Argumenten durchzusetzen: Sie erlassen nur Edikte, da die Macht bei ihnen ist. Ich meine nicht, daß man dem ganzen eine so billige und einfach auflösbare Moral abgelesen kann, wie dies Jörg Lau in seiner Rezension besorgt hat:
Das Spiel ist schnell durchschaut, und die an allen Ecken und Enden hervorquellende Botschaft dieser bläßlichen Phantastik dürfte konsensfähig sein: Seid bloß froh, daß es euch nicht so ergangen ist, verdient hättet ihr es nämlich. Dann wieder schwingt in all dem auch der autoritäre Strafwunsch mit, es hätte so kommen mögen, man wäre dann auch ein Opfer und als solches entlastet und aller Verantwortung ledig.
Wer sich wie Ransmayr auf diese heikle Problematik einläßt, wer, so wie er experimentell, in vitro, eine solche Welt entwirft, muß sich solcher Kritik stellen. Wie ist dem zu begegnen, läßt sich dem überhaupt begegnen?
Erzählen in Bildern
Bis jetzt haben wir uns nur dem moralischen, historischen und ethischen Problemen gewidmet, vor die uns dieser Text gestellt hat. Ihnen kann man auch nicht entkommen. Wenngleich man manchmal Mühe hat, die palimpsestartig verborgenen historischen Anspielungen zu erkennen, so sind sie doch deutlich genug: Der Text kann nicht ohne seine historischen Implikationen gelesen und interpretiert werden. Zum anderen erschwert Ransmayr gerade diesen Zugang, da er sich und seinen Text gegen jede Einnahme im Dienste einer Weltanschauung oder eines politischen Programms abschottet. Es scheint unmöglich, die einzelnen Handlungsteile in eine kausale Abfolge zu bringen. Mit einer Hartnäckigkeit, die respektabel ist, versperrt sich dieser Text auch jeder psychologischen Kausalität – hierin Handke nicht unähnlich. Entscheidend ist auch, daß dieser Text – zum Unterschied von Bernhard und Jelinek – eben doch mit Entschiedenheit am Erzählen festhält, ja daß ein omnipräsenter Erzähler unangefochten über allem zu thronen scheint, daß er die Ereignisse erzählt, als ob sie nur so und nicht anders zu erzählen seien. Man denke an Haslingers fünf verschiedene Perspektiven, die er benötigt, um den Ereignissen und den Lebensläufen der Figuren gerecht zu werden; man denke an Jelineks Aufhebung des Erzählens. Lediglich Handke hat immer wieder die Autorität der Erzählung beschworen, so schon in seiner Lehre der Sainte Victoire: »Meine Sache konnte nicht die rein im Sachgebiet die Bezüge suchende Abhandlung sein – mein Ideal waren seit je der sanfte Nachdruck und die begütigende Abfolge eine Erzählung.« In seinem »Königsdrama« Zurüstungen für die Unsterblichkeit führt Handke auch eine »Erzählerin« ein: Diese versucht nun, von ihrer Biographie ausgehend in dem Temporalgefüge »Und...als...nachdem...als.....nachdem...« ihr Leben zu erzählen; sie hat Erfolg, man hört ihr zu, sie kommt auf Erzählschulen, aber: Auf der einen Seite wurde mir vor lauter Wirklichkeit und Wissenschaft jedwedes Wirkliche unwirklich; auf der andern Seite lernten wir so lange tiefes Atmen, entgrenzende Ruhe und entselbstende Freude, daß sich bei mir außer Ruhe und Atmung rein nichts mehr tat; und auf der dritten war mir einfach das Gras zu grün und der Himmel zu blau. So bin ich freie Wandererzählerin geworden, nirgends fest, ohne Sitz oder Residenz, auf eigene Faust. Diese Apotheose des Erzählens begegnet ja auch am Ende des Romans Die Wiederholung (1986). Bei Handke steht aber hinter dem Erzählvorgang nie eine so gelassene und souverän verfügbare Instanz. Es wird kein Hehl daraus gemacht, daß der Rückgriff in eine so archaische Welt, sei es die Tomis, sei es die Moors, auch einer so beruhigten und abgeklärten Erzählhaltung bedarf. Hier meldet sich kein Interlocutor zu Wort, der Erzähler setzt sich hinter keine Fernsehkamera, er stellt sich manchmal hinter eine Person, verläßt deren Perspektive ebenso ungescheut wieder, erzählt wiederum Vorgänge, ohne uns Einblick in das Denken seiner Figuren zu geben. Am ehesten werden wir mit der Innenwelt Berings vertraut, aber diese Lotungen gehen nicht sehr tief. Es genügt die Oberfläche, es genügt die Aufzählung: Manchmal schwelgt der Erzähler auch in den Bildern des Verrottens, des Verfalls organischer Substanzen, des Natur-Häßlichen, des Katastrophalen, des Schäbigen: oder es wird aufgezählt, was dem Ganzen den Schein des noch Naturhaften gibt. Es sind dies die Anzeichen eines Untergangs, einer apokalyptischen Stimmung, und es hat doch schon ein Untergang stattgefunden. Immer wieder wird das Motiv der apoklayptischen Reiter – manchmal auch nur am Rande – angeführt. Aber es ist diese Verbildlichung des Untergangs, die eine ganz eigentümlich Dynamik erzeugt. Mit ihr hängt auch die Krankheit Berings zusammen, die freilich in Moor nicht diagnostiziert werden kann, da hier jede ärztliche Hilfe fehlt. Die Verfinsterung des Blicks sorgt dafür, daß dem Menschen die Bilder von der Welt verlorengehen: So erkläre ich auch die plötzlich so brutale Ermordung der zwei Vogelmenschen im Gebirge, wofür Bering ja auch von Lily verachtet wird. Diese Trübung des Blickes ist indes nicht nur eine individuelle Blendung; in einer hochdramatischen Szene muß Bering erfahren, daß das Loch in seiner Welt nur der lächerliche Fetzen einer größeren Dunkelheit war, nur einer von unzähligen blinden Flecken, die ihn umwirbeln und über ihm zusammenschießen zu einem einzigen Abgrund, einer einzigen Finsternis, durch die im nächsten Augenblick doch wieder die Wintersonne bricht (252).
Es ist auch dieser blinde Fleck, der den fatalen Schuß am Ende verursacht, mit dem er Muyra und nicht Lily tötet (435). Dieser blinde Fleck wird auch wahrgenommen, wie er den Karabiner auf die vermeintliche Lily hält: »Wo Lily ist, sind immer Flecken. Tarnflecken, blinde Flecken, immer ist da etwas, das ihn an Moor und an das erinnert, was er überstanden hat.« (435) Immer lenkt der Erzähler unseren Blick, und wir nehmen teil an der zusehenden Verfinsterung des Blickes, selbst wenn wir mit der Hoffnung auf Rettung und Heilung entlassen werden: Bering, der Leibwächter muß schauen, er muß scharf sehen können, aber die Krankheit zerstört seinen Gesichtssinn.
Die Leistung des Erzählens liegt vor allem darin, daß uns Bilder vorgeführt werden, ja es scheint, als wäre es deren Suggestivkraft, die auch die Handlung vorantreibt, als käme es darauf an, eher die Abfolge der Bilder glaubhaft zu gestalten und weniger die psychische Kausalität zu berücksichtigen. Dieses Erzählen möchte durch die Kraft der Bilder die Autorität des epischen Erzählens enthalten; noch einmal wird eine geschlossene Welt simuliert. Zwar wölbt sich (um an Lukács' Romantheorie zu denken) nicht der Himmel der Götter über diesen Figuren, aber sie sind auch nicht in die »transzendentale Obdachlosigkeit« entlassen. Der Roman setzt mit einem Bild ein, dessen Auflösung der Leser am Ende erfährt. Es ist eine nach filmischen Prinzipien gestaltete Szene: die zwei Toten die »schwarz im Januar Brasiliens liegen« (7) werden herangezoomt, dann wendet sich der Blick zur dritten Leiche. Anschließend kommt das Vermessungsflugzeug und stellt bloß fest, daß es sich um eine Wüste handle, um unbewohntes Gelände: Die Leichen verschwinden wieder in der Natur. Der Roman beginnt mit der Auslöschung jener beiden Figuren, die vor allem die Handlung getragen haben. Die Ereignisfolge in der letzten Szene erläutert den Blickinhalt: Ein spannender Showdown, in dem eine unbewußte Reaktion den ersten Mord bedingt und den Tod Ambras' und Berings zur Folge hat. In der letzten Szene springt der Erzählstandpunkt mehrfach um: Lily, Bering, Muyra, Bering, Ambras – der Erzähler ist in der Todessekunde dabei. Die Erklärung, warum nun diese Katastrophe ausgerechnet in Brasilien erfolgt, warum ein so komplizierter und höchst reißerischer Schluß das Ganze krönen muß, läßt sich aus der Logik der Erzählung so einfach nicht ableiten. Es kommt aber vermutlich nicht auf die Logik der Erzählung an, sondern vielmehr auf die Bilder, die da beschworen werden – bedrückende Bilder, die keine Befreiung zulassen. Schließlich endet alles in Verrottung und Brand. Die menschlichen Körper gehen in dieser unermeßlichen Natur wieder auf, die Geschichte wird vom Urwald überwachsen und nur durch die Kraft der Erzählung überhaupt ins Bewußtsein gehoben.
Was bleibt, ist wieder eine Welt ohne Menschen: Eine Vision, mit der auch Die letzte Welt geendet hatte. Was bleibt ist auch ein Text, der nicht einer einsinnigen Lesart unterworfen werden darf, einer Lesart, die sich damit begnügt, aus allem die politische Substanz herauszupräparieren. Mag sein, daß da manches schief ist, manches auch schräg herauskommt, manches in seiner Symbolhaftigkeit entweder nicht nachvollziehbar oder schwer erträglich ist. Ein Erzählen, das sich bewußt nicht auf verbürgte Praktiken moderner epischer Gestaltung einläßt, das ohne den inneren Monolog, ohne Problematisierung der Erzählerfiktion, ohne längere analytische oder essayistische Einschübe auskommt, ein solches Erzählen, das sich ganz bewußt auf das Postament des epischen Erzählens stellt und sich den Bildern und ihrer Symbolkraft anvertraut, läuft Gefahr, als glatt und klassizistisch, als altertümelnd oder gar als kitschig denunziert zu werden. Und es gibt in der Tat Stellen, die störend und verstörend wirken, und ein Reich-Ranicki würde sicher die sehr gedämpfte Darstellung des Erotischen oder Sexuellen tadeln, die ja die meisten Figuren als nahezu geschlechtslose Wesen präsentiert und Berings Leben in Moor ja als geradezu unglaublich eremitisch darstellt.
Zum anderen wäre zu fragen, ob man nicht in einem gewissen Überschwang und im Vertrauen auf eine der Wissenschaft und Wissenschaftssprache angenäherte Literatur auf Möglichkeiten und Aufgaben der Literatur vergessen hat, nämlich Zusammenhänge jenseits der wissenschaftlichen Diskurse zu erkennen, Bilder zu evozieren, die uns berühren, auch wenn wir den Grund dafür nicht erfassen können, Handlungen, die uns überzeugen, auch wenn wir sie in ihrer Kausalität nicht fassen können. Das freilich muß Spekulation bleiben, indes zeigt die einigermaßen zerklüftete Rezeption gerade dieses Textes, daß es doch auch an diesem Buch so etwas wie ein Faszinosum geben muß, das auf diese Archaismen zurückgeht. Die Errungenschaften der literarischen Moderne liegen gleichsam im blinden Fleck dieser Prosa: Sie selbst ist, so könnte man boshaft formulieren, von diesem Morbus Kitahara geschlagen. Doch wäre es – gerade was die Entwicklungen der literarischen Formen angeht – verfehlt, einen gleichmäßigen Progreß in bezug auf eine Richtung anzunehmen. Postmodernes Schreiben ermöglicht auch solche bewußten Rückgriffe oder die Mißachtung von Postulaten des Zeitgemäßen. Ob Ransmayrs Verfahren tatsächlich Anknüpfungspunkte für eine moderne Prosa darstellt, bleibe hier dahingestellt. Der Mut, mit dem eine so heikle Frage angeschnitten wird, ist beachtlich. Aber auch husarenhafte Kühnheit macht noch keinen Schriftsteller.
Österreichisches
Mit diesem Buch hat Ransmayr wieder ein österreichisches Szenario gewählt. Schauplatz ist die Provinz, die wir bei Menasse, bei Haslinger, bei Jelinek und auch bei Bernhard finden: Nur hat Ransmayr ihre Rückständigkeit drastisch vergrößert. Allerdings erinnert viel an die Zeit unmittelbar nach dem Krieg, und dies mit peinlicher Deutlichkeit. Der Roman zeichnet auf, was die Historiographie nicht zu erfassen gewohnt ist. Die Provinz ist auch der Nährboden für die Remythisierung; ein kultisches Allerlei wird dargeboten, das sich in katholischen Bräuchen aber auch in von den Siegermächten übernommenen Festlichkeiten (die Schilderung des Konzerts gehört zu den besten Partien des Buches) manifestiert. Die Natur ist immer wieder Wildnis; sie hat die Relikte einer Zivilisation von einst und ihre technischen Monumente überwuchert. In dieser Hinsicht koinzidieren viele Autoren; bei Bernhard ist es die radikal böse Natur, bei Jelinek eine Natur, die immer wieder zuschlägt und die kein Maß für die Menschen ist, bei Menasse wie bei Ransmayr ist sie auch ausgebeutet – der Steinbruch funktioniert nicht mehr. Allenthalben drohende Öde und Leere. Es ist immer gut, auf Gegenbeispiele zu verweisen. In diesen Negativbildern der Umwelt spricht sich ambivalent die Furcht vor der Natur aber auch die Angst vor ihrer stets drohenden Vernichtung aus. Handke hat in seinem Roman Die Wiederholung und in anderen Schriften Gegenbilder wider diese Endzeitvisionen von Natur errichtet. Auch bei ihm soll die Kraft des Bildes überzeugen. Der Ich-Erzähler in dem Roman findet im Karst eine Doline, wo die Menschen in friedlicher Arbeit leben. Dieses Bild ist geradezu eine Versicherung, daß es Orte geben werde, an denen keine Katastrophe eintreten werde:
So freundlich war der Raum, in den ich hinabblickte, und eine solche Kraft stieg aus der Tiefe empor, daß ich mir vorstellen konnte, selbst der Große Atomblitz würde dieser Doline nichts anhaben; der Explosionsstoß würde über sie hinweggehen, ebenso wie die Strahlung. Und in der Vorwegnahme sah ich dann die zu meinen Füßen, in der fruchtbaren Erdschüssel, Tätigen als Rest-Menschheit, nach der Katastrophe, wie sie wiederanfing zu wirtschaften. [...] Das Bild der in die Karsterde eingesenkten Plantage, vor jedem Feindeinfall geschützt, atombombensicher, unter freiem Himmel, als eines Ziels hat mich bis heute nicht verlassen, samt dem Transistorgedudel aus der steinernen Feldhütte als meinem Preislied. Bild? Chimäre? Fata Morgana? – Bild; denn es ist in Kraft. Aus dieser Stelle wird sehr schön ersichtlich, wie diese Texte zueinander in einen Dialog treten, zumindest dann, wenn sie von uns zusammengeführt werden. Dieses Gespräch über die Natur führt verschieden Standpunkte gegeneinander vor; es fällt schwer, sich da zu entscheiden, aber wenn Literatur und Literaturwissenschaft Sinn macht, dann wohl den, daß wir diesen Dialog hören können, daß wir das Schreiben in seiner Freiheit belassen und erkennen, wie sehr wir es auch für den Haushalt unserer Argumente benötigen
Robert Menasse: Schubumkehr (1995)
»Im Anfang ist die Kopie« – dieser Satz, mit dem Robert Menasses (1954) philosophische Schrift Phänomenologie der Entgeisterung schließt, kann mit Grund am Beginn jeder Erörterung von Menasses Schriften stehen: Er enthält Programm und saloppe Ummünzung des Johannes-Evangeliums mit seinem Einsatz, der sehr wohl als einer der prägenden Leitsätze dem Denken in der christlich-humanistischen Tradition eingeschrieben ist. Der Logos ist also gleichsam zur Wiederholung, zum Zitat, zur Kopie verkümmert. Zugleich aber steht diese am Anfang und damit aber auch, im Sinne Menasses am Ende eines Prozesses: Der Text, den er vorlegt, vergißt nie, daß er Kopie ist, und er teilt dies unmißverständlich mit. Das ist das Spiel, das er so mit dem Leser treibt. Der Roman Schubumkehr, der dritte einer Trilogie, deren Teile mehr oder weniger lose durch Figuren und Motive verknüpft sind, ist bereits schon im Titel Zitat, das sich auf den ersten Blick mit dem Romanganzen nicht so leicht verbinden läßt. Schubumkehr war als Begriff einer größeren Öffentlichkeit bekannt geworden, als im Mai 1991 ein Flugzeug der Lauda-Air über Thailand abstürzte, wobei die Ursache in der Schubumkehr lag, die sich automatisch eingeschaltet hatte, lag; wenn dies geschähe, so müßte es, wie Lauda erklärte, alles zerreißen: Statt nach vorne, würde nun das Flugzeug in die Gegenrichtung geschleudert. Menasse meinte damals, daß dies der Begriff sei, der wie kaum ein anderer die europäische Situation nach 1989 träfe: Es würde eben alles zerrissen. Schubumkehr zielt, so will es der Wille des Autors mit dem Sinne fürs Epochale, auf eine Zäsur, deren Konsequenzen kaum überdacht oder bedacht worden wären. Zudem sei bemerkt, daß dieser Text der erste und einzige ist, der in der erzählenden Literatur aus Österreich diese epochale Veränderung denn auch klar thematisiert hat.
Daß dem so ist, ist gewiß aufschlußreich, wichtiger aber für die hier (von mir) gewählte Vorgangsweise ist die Frage, wie dieses Ereignis thematisiert wird. Und diese Thematisierung läßt sich sehr schön aus der Typologie der Kopie entwickeln: Es beginnt mit einer Kopie, denn die Fiktion (ob dies künstlerisch zuträglich ist oder nicht, mag vorerst unentschieden bleiben) besteht darin, daß wir, die Lesenden, die Zuschauenden sein sollen, und zwar sehen wir eine Kopie eines Videos, das eine der Hauptfiguren, Roman Gilanian, gemacht hat. Wir sind damit – ähnlich wie in Haslingers Opernball – auch auf die Kameraperspektive festgelegt, aber – und diese Askese hält nicht vor – es gibt in dem Roman doch offenkundig auch eine Erzählinstanz, die dieser Perspektive vorgeblendet wird, so daß diese Kameraführung zu einem, wie ich meine, manchmal etwas lästigen, und für den Autor – Gott sei Dank – auch etwas lästigen – Medium wird. Aber gerade das ist aufschlußreich: Eben weil diese Fiktion des Kamerablicks letztlich eher ornamental und nicht funktional ist, weil sie also entbehrlich ist und jedem, der der thematischen Substanz des Romans nachspüren will, eher hinderlich denn förderlich zu sein scheint, gerade deshalb ist sie wichtig – erscheint sie doch als unentbehrliches Ausstattungsrequisit des Romans, um dem Leser der Kopierbarkeit, des Wiederholbaren zu versichern. Diese Kamerafiktion halte ich für einen Einschluß im Romanganzen, dessen ästhetische Funktion nicht präzise geklärt werden kann, denn die Kamera ist im entscheidenden Augenblick nicht dabei. Da inthronisiert sich wieder der Erzähler, gar nicht sonderlich auktorial, aber doch sehr dezidiert: Roman sieht zwar am Schluß die seltsame Szene, da die beiden Kinder den Kleidertausch durchführen, er sieht aber nicht, daß sich »die Männer« dem Mädchen nähern, er sieht auch das Verbrechen nicht. Doch davon später.
Handlung
Die Handlung kennt mehrere Zentren. Menasse hat hier ganz bewußt an die epizentrische Praxis eines Heimito von Doderer angeknüpft, der ebenfalls von verschiedenen Einsätzen kommend, die einzelnen Figuren zusammenführt. Ein Handlungsstrang ist die Geschichte des Roman Gilanian, der nach einigen merkwürdig bedrückenden Erlebnissen aus Brasilien heimkehrt, und da just in die tiefste österreichische Provinz kommt, nämlich – im EU-Jargon als less favoured region bezeichnetes Territorium, das Waldviertel, in das den Nordosten des Bundeslandes Niederösterreich ausmacht. Die Mutter Anne, eine Witwe, möchte dort mit einem um zwanzig Jahren jüngeren Mann als Biobäurin ein neues Leben anfangen, was aber nicht gut ausgeht, weil der junge Mann eben doch eine jüngere findet, begehrt und auch bekommt. Aber das bleibt schon am Rande.
Im Zentrum steht der Bürgermeister der Gemeinde Komprechts (einen Ort dieses Namens gibt es im Waldviertel nicht); der Bürgermeister König versucht, das Interesse an diesem Ort zu wecken; dieser steckt in einer großen Krise – der Steinbruch und die Glasfabrik sehen sich einer sehr ungünstigen Auftragslage gegenüber – , und die Krise soll durch den »sanften Tourismus« behoben werden. Der Bürgermeister selbst, ein Sozialdemokrat, ist in unzählige Konflikte verstrickt und letztlich glücklos. Die Affäre mit einer Kellnerin wird durch ihre Verehelichung vertuscht, obwohl alle davon wissen; sie bekommt ein Kind, dessen Zeugung vermutlich durch den Bürgermeister vorgenommen wurde. Zugleich hat er sich den Haß der Frau Nemec zugezogen, da er ihren Wald und ihre Aussicht durch den Umbau und die Zurüstungen für den Tourismus zerstört hat. Sie vergiftet ihn mit einer Schwammerlsauce: Eine echte Hexe, die genau weiß, wo man die Pilze findet und wie man so etwas zubereitet. Diese folkloristische Seite wird uns noch später beschäftigen.
Der Bürgermeister, der entschieden die Aussiedlung der Frau Nemec aus ihrem Haus betreibt, wird nun das Opfer einer atavistischen Rache: Die Natur, die er, um daraus einen Naturpark zu machen, zerstört hat, rächt sich in Gestalt der alten Frau. Doch nicht genug an dem: Das eigene Kind wird offenbar Opfer eines Sexualmordes. Es tauscht die Kleider mit dem fremden Mädchen (das nie so richtig ins Bild des filmenden Roman, aber auch nicht in den Blick des Lesers kommt), dann kommen eben die »Männer« – dem Bürgermeister wird die Untat gemeldet; schon sterbend sieht er, daß es sich um seinen eigenen Sohn Bruno Maria König handelt – man merkt, der gewählte Vorname deutet schon auf die geschlechtliche Ambivalenz des Knaben hin. Doch damit ist das Ende nicht erreicht. Was mit König an diesem Septembertag weiter geschieht, erfahren wir nicht. Nur Roman verläßt den Ort und die Heimat und die Mutter, die ihn so gepeinigt hat. Und noch ein anderes rahmendes Element wird uns noch in einem anderen Zusammenhang beschäftigen.
Dies wäre in etwa der Handlungsrahmen, innerhalb dessen sich die wichtigsten Vorgänge abspielen, aber das vermittelt doch nur eine unzulängliche Vorstellung von der Komplexität des ganzen Romans. Kaum ein Detail, das nicht auf ein anderes abgestimmt wäre, kaum ein Vorkommnis, das nicht Echo eines anderen wäre. In formaler Hinsicht weckt dieses Buch den Eindruck einer perfekten (ja fast zu perfekten) Kombination. Wir werden bezüglich einiger Details noch in anderem Zusammenhang darauf zu sprechen kommen. Zunächst einmal sei versucht, diesen Text mit den anderen hier in Rede stehenden, so gut es geht, zu vernetzen. Einige Details haben uns schon bewußt gemacht, wie deutlich sich die formalen Strategien und zentralen Themen dieses Romans mit den anderen verbinden lassen. Wäre es nur die Fabel, so würde dieses Buch mit Grund als nicht schlecht gelungene Unterhaltungsliteratur zur Seite gelegt werden müssen. Doch gibt die Strategie des Autors diesem Buch seine ganz unverwechselbare Signatur. Ich bin davon ausgegangen, daß die Schubumkehr von 1989, die ja für Österreich doch eine ganz andere Rolle als für Deutschland spielte, an der Textoberfläche kaum wahrgenommen werden kann.
Das Buch scheint sich auch als das zu gerieren, was Robert Menasse in seinen theoretischen Studien zur österreichischen Literatur als deren Wesensmerkmal mehrfach hervorgehoben hatte: Diese sei eine zutiefst provinzielle Literatur. In der Tat wird man, wenn man Literatur aus Österreich im Ausland diskutiert, um eine Erörterung dieses Komplexes nicht herum kommen. Der antiurbane Effekt bestimmte meist die Literatur der Zwischenkriegszeit. Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften galt lange ja als der letzte urbane Roman. Auch nach dem zweiten Weltkrieg wurde wiederum, wenngleich mit geänderten Vorzeichen, die Provinz zum Schauplatz, und ein ins Gräßliche abgewandeltes Rustikales zum wichtigen Substrat. Die Ausnahme Doderer – in ihm läßt sich der letzte Versuch einer urbanen Literatur von Rang in Österreich ausmachen – hatte bei der jüngeren Generation kaum, sieht man von Menasse ab, Schule gemacht. Es wäre nun grundsätzlich verfehlt, eine Affirmation des Provinz-Topos in der österreichischen Literatur erblicken zu wollen, sehr wohl aber dessen Kopie. Menasse kopiert und zitiert bewußt diese nach 1945 so starke Tradition des Provinzromans, der Provinzerzählung herbei. Er produziert letztlich eine Dorfgeschichte des 20. Jahrhunderts, deren Unglück es eben ist, daß ihr Schauplatz das Dorf zu sein hat. Indem die Tradition aufgerufen wird, wird sie problematisch. Zugleich wird klar, daß diese Vorliebe für die provinzbezogene Literatur, die noch immer nicht von der Scholle wegkommt, eben für die politische und soziale Situation Österreichs verantwortlich ist. Mit anderen Worten: Wer von der Provinz erzählt, erzählt von Österreich, oder: Komprechts ist Österreich. Diese »Schubumkehr« soll also durch die Vorgänge in Komprechts symbolisiert werden. Die Dorfgeschichte mutiert auf diese Weise zum Staatsroman, und die einzelnen Handlungsträger zu Repräsentanten.
Das Phänomen der Simulation
Im Zusammenhang damit lassen sich nun einige Aspekte hervorheben, die auch mit den anderen Texten in Beziehung gesetzt werden können. Zunächst einmal das Phänomen der Simulation. Wie kaum ein anderer Autor setzt Menasse auf die Simulation. Alles scheint sich in einem Zustand des »Als ob« zu befinden. Nichts ist real; immer dann, wenn etwas besonders abstrus erscheint, ist es real. Der Herr dieser Simulation ist der Bürgermeister König; er ist damit auch gleichsam der idealtypische Repräsentant Österreichs. In seinem Namen spiegelt sich die Geschichte des Landes: Ursprünglich hieß die Familie Kral, was so viel wie König bedeutet; 1938 wurde daraus König, und als Wunschkennzeichen (seit 1989) ließ sich nun König auf sein Nummernschild King schreiben. Und ein boshafter Zeitgenosse machte daraus ein Kong.
Menasse ist ein Meister im Umgang mit solchen symbolischen Repräsentationen; er bemüht sich seit Jahren, die österreichische Chiffrensprache zu dekodieren. Dazu gehört eben auch dieses Spiel mit der Namens-identität. Mehr noch: König repräsentiert in sich auch das Schicksal jener Partei, die in den siebziger und achtziger Jahren die staatstragende Partei war – die Sozialdemokratie. Sie ist ihrem Erbe untreu geworden, sie ist verbürgerlicht. Sie paktiert, sie kennt keine klaren ideologischen Vorgaben. Sie setzt auf Kompromisse, ja sie kann nur durch Kompromisse überleben. Sie versucht, ohne historisch redlich vorzugehen, sich aller Traditionen assimilatorisch zu bedienen. So ist dieses Buch denn auch ein Buch, das die Krise der österreichischen Intellektuellen trifft, die sich eben in der Ära Kreisky eine neue österreichische Identität im Rahmen eines internationalen Sozialismus erhofft hatten. Dabei ist aber vorerst nicht mehr herausgekommen als das Bewußtsein der Marginalität. Dies ist ein Punkt, auf den Thomas Bernhard ja des öfteren verwiesen hatte. Die Wahl des Schauplatzes ist daher alles andere denn unabsichtlich: Der Rand Österreichs ist also der Rand des Randes. Das Bewußtsein, daß klein schön ist, ist also dem Bewußtsein der Marginalisierung Österreichs gewichen. Ein solches Territorium ist wie geschaffen für die Simulation: Die Trennungslinie zwischen Realität und Fiktion wird unscharf. Etwas ist nur, wenn es in den Medien ist. Die Simulation durch die Medien ist, was für Komprechts zählt. Simulation auf dem Theater, Simulation durch das Museale.
Der Roman wird durch zwei solche Simulationshandlungen gerahmt: Zunächst einmal ist es die Theateraufführung, deren Folgen fatal hätten sein können: Das Nordlicht läßt die Feuerwehr auffahren, auf der Bühne wird ein Stück gegeben, in dem auch ein Brand vorkommen soll. Die Sirenen der Feuerwehr sind zwar in dem historischen Stück ein grober Anachronismus, aber sie passen dann doch ganz gut hinein: Das Nordlicht, ein übles Vorzeichen, das meist auf Krieg hindeutet, läßt auf einen Brand schließen; die Feuerwehr rast los, sie durchfährt den tschechischen Grenzbalken, und die so komisch wirkende Truppe sieht sich den tschechischen Maschinengewehren gegenüber. Bühnenwirklichkeit und Wirklichkeit geraten durcheinander, übrigens ein in der Literatur der jüngeren Vergangenheit geradezu topisch eingesetztes Verfahren. (Man vergleiche etwa in Werner Koflers Hotel Mordschein die Geschichte vom Verschwinden der Königin der Nacht.) Der Bürgermeister wird zur tragikomischen Figur: Er riß die Hände hoch, immer noch im Kostüm des Grafen Wenzel, mit rotgeschminkter Nase, dazu jetzt auch noch mit Feuerwehrhelm, hinter sich hörte er die Sirene von Komprechts, neben sich das Folgetonhorn des Feuerwehrwagens, und vor sich das schrille Jaulen des tschechoslowakischen Grenzalarms. (15)
In diesem Roman finden sich die politischen Parteien Österreichs in schön zwieträchtiger Eintracht vertreten: Der sozialdemokratische Bürgermeister spielt eine tragende Rolle, die Tochter des konservativen Vizebürgermeisters hat ebenfalls einen wichtigen Part zu spielen, und Verfasser des Ganzen ist der Grüne Gemeinderat und Oberlehrer Vinzenz Trisko. Was hier gegeben wird, ist die Farce, die hier nicht auf die Tragödie folgt, sondern zu der diese geworden ist. Diese Abfolge von Tragödie und Komödie spielt in den Textstrategien der österreichischen Autoren eine große Rolle: Auch wenn die Simulation poetischen Prinzipen nicht zu gehorchen braucht, so horcht sie doch auf diese: Theatralisches läßt den Zuschauer immer fragen, was er vor sich habe, eine Tragödie oder eine Komödie. Es ist Menasses Geschick, tatsächlich das Ganze als Farce zu entwerfen und zu zeigen, wie die Verhältnisse in der Karikatur (der Bürgermeister in seinem seltsamen Kostüm) erst kenntlich werden – ein Verfahren, das Thomas Bernhard ja vor allem in Alte Meister als ein Movens des Schreibens überhaupt dargestellt hatte. Zugleich holt die Figuren der eigene Kreativität auf verhängnisvolle Weise wieder aus den Höhen herunter: Trisko kann es nicht lassen und hat wiederum ein Stück geschrieben, das kaum wahrgenommen wird, wäre darin nicht der Mord am Sohn des Bürgermeisters symbolisch antizipiert worden; bezeichnenderweise bemüht er dafür eine Ortslegende: Alle acht Jahre fordert der See seine Opfer, und weil nun in der Realität tatsächlich eintritt, was in diesem Stück steht, wird der arme Oberlehrer in Vorbeugehaft genommen. In der Wirklichkeit wird mit der Literatur ernst gemacht. (163-169)
Vor allem die Widersprüche reizen Menasse; der unschuldige Lehrer, der durch die Literatur schuldig wird: Dieser Widerspruch macht ein an sich belangloses Stück Literatur zu einem Signal der Befindlichkeit sowohl der Literatur wie auch der politischen Realität Österreichs. Die sublime ironische Pointe liegt eben darin, daß auch durch schlechte Literatur, durch minderwertige Fiktion gleichsam die tatsächlichen Ereignisse erst ihren Umriß gewinnen. Alles in der Literatur hat also auch sein fundamentum in re, oder umgekehrt: Durch die Literatur, durch die Existenz der Fiktion werden die Tatsachen erst zu Tatsachen.
Der ideale Raum für die Simulation ist das Museum. Vom Museum war schon des öfteren die Rede; nicht umsonst hat sich Reger in Bernhards Alte Meister in das Museum zurückgezogen; Werner Kofler hat sich immer wieder (Am Schreibtisch, 1989) besonders über Geschichte als Erlebnisraum lustig gemacht. So wird auch hier, um den sanften Tourismus zu fördern, ein Steinbruchmuseum geplant – »das erste in Österreich«. (98) Da authentische Arbeit nicht möglich ist und nicht mehr verteilt werden kann, wird sie museal konserviert. Wenngleich postmodernes Denken nirgends so zu sich selber kommen kann wie in der abgeschlossenen Atmosphäre des Museums, so ist der Museumstopos in der österreichischen Literatur schon seit geraumer Zeit gängig: Hermann Broch hat in seinem Essay Hofmannsthal und seine Zeit bereits darauf hingewiesen, daß sich Wien als ein Museum seiner selbst einzurichten begonnen hätte, Dinge zu präparieren, sie zu konservieren, gleichsam die facies hippocratica des einstmals Lebendigen herzustellen, ist eine Motivkonstante in der österreichischen Literatur, der einmal intensiver nachzugehen wäre (Herzmanovskys Exzellenzen ausstopfen, ein Unfug; Saikos Auf dem Floß; Bernhards Korrektur mit dem Tierpräparator Höller). Hier handelt es sich allerdings nur um ein bescheidenes Provinzmuseum, das allerdings zugleich den verhängnisvollen Status der Gesellschaft anzeigt: Das Authentische, das den Menschen (und die Verkrüppelung durch die Arbeit wird auch beschrieben) nicht mehr zur Verfügung steht, wird ersetzt durch das Museale. War die Arbeit schon ein Terror, so ist die Aufhebung, hier im Doppelsinne verstanden, der lebensnotwendigen Arbeit durch das Museale erst recht ein Terror. Ein Leben im Inauthentischen, ein Leben, das den Künstlern nachgesagt wurde, soll die Gesamtheit dieses seiner sozialen Substanz beraubten Gemeinwesens treffen.
Mythen
In einer solchermaßen beschaffenen Gesellschaft ist auch Platz für neue Mythen und Mythenbildungen. Das Nordlicht, die Geschichte, daß der See alle acht Jahre ein Kind als Opfer fordert, die drei Engel, die plötzlich vor der Haustür der Frau Nemec stehen und die Apokalypse ankündigen – all dies verweist auf die Katastrophe: Durch den Eisbruch wird die Landschaft radikal verändert, auch dies ein Zeichen der herannahenden Katastrophe: Da passiert etwas, das Frau Nemec nicht einmal vom Hörensagen kannte, das im Erzählenhören unglaublich klingen mußte – die Augenzeugen aber entsetzte. [...] Während eines plötzlichen Temperatursturzes wogte, von scharfem Nordostwind getrieben, ein sehr dichter Nebel her – und kristallisierte sich an den Bäumen. Die Eiskruste, mit der er Stämme und Äste umzog, […] nötigte die Bäume zur Beugung, Brechung, Niederlage. [...] Es sah aus, als hätten unzählige Bomben eingeschlagen, ein Schlachtfeld, ein Trümmerhaufen. [...] Selbst wenn man ihn wieder aufforsten wird, sie wird ihn nie wieder so sehen, wie sie ihn kannte. (24)
Hätte Frau Nemec Stifters Die Mappe meines Urgroßvaters gelesen, so hätte sie das Phänomen gekannt. Und Menasse kennt es vermutlich auch von dorther, denn die Beschreibung dieses Eisbruches ist durchaus an der Stifters angelehnt. Doch ein markanter Unterschied verdient Erwähnung: Bei Stifter wird die Naturkatastrophe zwar auch sehr eindringlich beschrieben und die Folge für die verschiedenen Waldsorten sichtbar gemacht, doch erweist sich der Schaden als überwindbar, ja letztlich sogar als Nutzen. Stifter: Die Bäume belaubten sich sehr bald, und wunderbar war es, daß es schien, als hätte ihnen die Verwundung des Winters eher Nutzen als Schaden gebracht. Sie trieben fröhliche junge Schossen, und wo einer recht verletzt war, und seine Äste gebrochen ragten, und wo mehrere beisammen standen, die sehr kahl geschlagen waren, kam eine Menge feiner Zweige, und es verdichtete sich immer mehr das grüne Netz, aus dem die besten fettesten Blätter hervorsproßten.
Hier wird – repräsentativ nicht nur für Stifter sondern auch für die österreichische Literatur – eine Form des Krisenmanagments erkennbar, die den Schaden als den verkappten Förderer des Guten wirksam werden läßt. Die Natur-Katastrophe bei Menasse hingegen erweist sich nicht nur als nicht umkehrbar – noch schlimmer, sie wird auch Anlaß zu einem durch die Menschen erfolgenden Eingriff in das Naturgeschehen, dessen Folgen noch um einiges verheerender sind: »Wo die Krater und die kreuz- und quer liegenden Baumstämme gewesen sind, war nun eine planierte Fläche voller kleiner Setzlinge.« (148) Eingeebenet waren sowohl die Unebenheiten von früher wie die Folgen der Naturkatastrophe. Die Natur wird in dem Sinne verwandelt, in dem die Reklame, die Werbung dies vorgesehen hat. Ironischer Höhepunkt ist das Gespräch Königs mit dem Werbefachmann, der dem ratlosen Bürgermeister das verwandelte Komprechts vor Augen führt: »Die Menschen wollen Natur, aber sie wollen keine Wildnis.« (139) Damit sind wir ganz in der Nähe von Jelineks Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr. Der Verweis auf Peter Handkes Text Epopöe vom Verschwinden der Wege oder Eine andere Lehre der Sainte Victoire von 1990 liegt auf der Hand: In diesem kurzen Text, der geradezu exemplarisch für das apokalyptische Szenario stehen kann, das seit dem Ende der achtziger Jahre von den österreichischen Autoren immer wieder heraufbeschworen wird, befällt den Ich-Erzähler »eine Art Hunger nach Wiederholung eines seiner bewährten Wege«. Doch ist ach einem Waldbrand die Landschaft völlig zur Unkenntlichkeit entstellt, ja es scheint so, als wären selbst die Wege, tief eingespurt in den Boden, verschwunden: Und das würde so bleiben auf unabsehbare Zeit; in diesem Kontinent (!) würde für Generationen von Betrachtern der Anblick der Nacktheit und der Asche vorherrschen; die paar aus dem Schutt nachsprießenden Steineichensproßen würden bei jedem neuen Regenguß wieder verschüttet werden; schon jetzt, ein paar Monate nach der großen Katastrophe, war die Mergelterrasse am Sockel des Massivs dabei, sich zu verlagern gegen die Ebenen, vom Wasser abgetragen zu werden, in Geröllawinen sich vom Berg abzusondern, die Bäche hatten ihren Lauf verlassen und sickerten lautlos irgendwo unterirdisch.
Beachtung verdient, daß Handke in seinem Roman Die Wiederholung – explizit bezieht sich ja gerade dieser Text ja auch durch das Motiv der Wiederholung auf diesen Roman – eine Idylle in einer slowenischen Doline darstellt, eben einer (ganz im Sinne Vergils) harmonischen Übereinstimmung von Natur und Mensch, ein utopischer Einschlag: Ein beträchtlicher Unterschied, der auf einen ganz anderen Zustand des Katastrophenbewußtseins verweist. Ebenso ist natürlich die gewaltige Schlußvision in Ransmayrs Die letzte Welt (1988) zum Vergleich heranzuziehen, worin ebenfalls die von den Menschen völlig entleerte, entvölkerte Natur die einsame Stimme des im Gebirgein sich gehenden Cotta auffängt und als Echo zurückgibt. Zusehends verdichten sich diese Visionen einer »Natur ohne Menschen«, wie Peter Rosei dies schon in einer viel früher erschienenen Schrift genannt hat. Menasses Apokalypse im Waldviertel nimmt sich dagegen wie eine Miniatur aus, wie das Diminutiv der Apokalypse; aber Vorsicht ist geboten: Immer wenn österreichische Schriftsteller etwas verkleinern, meinen sie etwas ganz Großes und nicht selten auch Gefährliches.
Provinz
Das Gefährliche in diesem Falle ist ohne Zweifel die österreichische Provinz. In sie wird der Held (er ist einer von vielen), Roman Gilanian, verbannt. Hier verfettet er; hier erlebt er den Naturwahn seiner Mutter; hier erlebt er, wie sich gewaltsam die »Schubumkehr« vollzieht, und er beschließt, zu filmen; daß ihm aber dabei Wichtiges entgeht, darauf haben wir schon oben verwiesen. Im Zeitraffer faßt er die einzelnen Phasen zusammen (12); ähnlich wie ein Zeitraffer funktioniert auch der Roman: Der Leser muß sich auch auf den jähen Bildwechsel einstellen. Die Provinz bewährt sich einmal als Schauplatz mit außerordentlicher Konzentrationsfähigkeit. Aus dieser Provinz ist auch das Verbrechen gekommen, aus dem Waldviertel stammte auch (wir sollen das ja nicht vergessen) die Familie Adolf Hitlers. Dementsprechend fühlt sich dieser Roman Gilanian auch in der Verbannung:
Er wird sich, kein Zweifel, am Ende an einem Ort finden, den er nicht kennt, ohne zu wissen, wie lange er dort würde bleiben müssen, was er dort tun könnte oder sollte. Was wird das sein? Eine schockartige Einschulung in Realismus? (59) Was ist das aber? Es ist Zitat, Zitat aus der Biographie des Georg Lukács, einer von Menasses Mentoren und Identifikationsfiguren in der ganze Romantrilogie und zugleich auch ein deutlicher Hinweis auf die besondere Situation des Helden: Lukács war ja bekanntlich als Folge der Revolution von 1956 von den Sowjets an einen ihm völlig unbekannten Ort verbracht worden – nach Rumänien, wie sich später herausstellte, aber das tut hier nichts zur Sache. Auf Grund dieser Erfahrung soll Lukács Kafka als einen der größten Realisten bezeichnet haben. Daher also »schockartige Einschulung in Realismus«. Damit soll also das Kafkaeske dieser Situation eingefangen werden, die Unwirklichkeit, die durch die systematisch betriebene Simulation in der Familie (durch die Mutter) und in der Politik (durch die Gemeinde Komprechts) erzeugt wird. Zugleich aber involviert dies auch ein Bekenntnis zur einer Art Realismus, mit dem sich Menasse im Gefolge von Lukács in der Theorie wie auch in der Praxis seiner Romanproduktion herumgeschlagen hat. Die Identitätsschwierigkeiten, denen sich Roman ausgesetzt sieht, werden noch durch seine jüdische Herkunft vergrößert. Parabolisch ist in diesem jüdischen Ritual bereits der Grundsatz von der Kopie, die am Anfang war, angelegt: Der Vater, der sich nicht als Jude fühlte und seinen Worten nach nur »als Jude verfolgt wurde«, hatte »zwei komplette Garnituren Geschirr«, und zwar: »Für Milchprodukte und Fleisch je ein eigenes Geschirr«, wobei aber das Verwirrende ist, aber daß die beiden Garnituren »absolut identisch« waren, so daß sie immer wieder durcheinandergebracht wurden und er sich immer wieder neue, natürlich immer wieder absolut identische Garnituren kaufte. (95) In dieser fast chassidisch anmutenden Geschichte ist nun die besondere Situation des jungen Roman Gilanian gleichsam symbolisch enthalten: Der besondere Blick für das Trennende im Identischen. So blendet Roman dauernd Wirklichkeit und Kunstwirklichkeit ineinander, erkennt den Hiatus, der zwischen der Einbildung und der Bildung besteht: »Er hatte ein Selbstbild und ein Spiegelbild, dazwischen lag eine lange Reise, auf der hatte er sich verloren.« (160) Markant auch eine Selbstbegegnung Romans:
Was er sah, war die Mischung aus der Faschingsausgabe eines Franziskanermönchs und dem Patienten eines Ostblock-Kurhotels auf dem Weg zur Schlammpackung. Er war nicht dumm und blind genug, um zu übersehen, daß er eine Karikatur abgab, sowohl von Weltentsagung als auch von Genesungssehnsucht. (171) Man vergleiche dazu eben auch die Stelle, an der sich Bernhards Held Murau in Auslöschung im Spiegel als Selbstentstellung betrachtet. Nahezu alle Figuren in der Literatur nach Bernhard sehen sich im Spiegel, treten sich so gegenüber. Natürlich ist diese Roman eine Ödipus-Attrappe: Als die Mutter von einem Gespräch mit ihrem Mann, der sie betrügt, zurückkommt und Scheidung und Gütertrennung geregelt hat, findet sie ihren Sohn in ihrem Bett vor, blutend: Er hat sich beim Brotschneiden verletzt. (vgl. 164f.) Die Fabel selbst soll auch eine mythische Überhöhung erfahren: Der filmende Roman läßt mit der Stimme aus dem Off etwas von einem schönen Hirsch erzählen (50f.). (Zum Hirschen heißt übrigens auch das Gasthaus in Komprechts.) Was so wie ein blindes Motiv aussieht, wird später noch einmal durch eine kleine mythographische Pointe überlagert. Erzählt wird die Geschichte von Athamas, der im Wahnsinn seinen Sohn Learchos tötete – allerdings so, wie es bei Apollodor heißt, wie man einen Hirsch tötet – nicht weil man einen Hirschen sah, sondern so wie man einen Hirschen auf der Jagd tötet. Diese mythologische Einlage, mit der Menasse offenkundig die ganze Szenerie der Tötung des kleinen Bruno Maria König einhüllen will, bleibt in der motivischen Substanz des gesamten Zusammenhangs doch auch einigermaßen unklar. Hier bricht der Text ab, und zwar an entscheidender Stelle – wie eben auch das Video abbricht (169).
Doch auch die ästhetische Funktion dieses so seltsamen Einsprengsels läßt sich erklären. Treten wir nun einmal zurück von diesem Bild aus der Provinz, das mit variierender Tiefendimension und mit einem oft etwas verwirrenden Blickwechsel vor uns entwickelt wurde, so läßt sich zunächst von einer perfekten Komposition sprechen, in der nicht das kleinste Detail ohne Kalkül plaziert ist. Nahezu jedes Motiv ist auf ein anderes abgestimmt, immer wieder tritt der zitathafte Charakter des Ganzen hervor, aber doch so, daß jedes einzelne Zitat sehr wohl auch seine Berechtigung und seine Perspektive auf ein anderes Detail hat. Nahezu alle Themen und Motive werden durchgespielt. Immer wieder scheinen die Muster durch, auf die sich der belesene Autor beziehen muß. Da ist die Madelaine Prousts, die geradezu zwangsläufig immer denn der Leser in den Mund bekommt, wenn er mit der Erinnerung konfrontiert wird. Er ißt die Madelaine, aber die Wirkung stellt sich nicht ein, und ironisch unterläuft Menasses Text damit auch das Credo aller postmodernen Erinnerungsfanatiker. Übrigens wäre es einmal höchst verdienstvoll, das Thema Erinnerung (oder memoria) in der neueren Literatur konsequent aufzuarbeiten. Ein Café heißt Madelaine, und dann ist schon alles da: Combray, die Madeleine, die Erinnerung. Doch Roman Gilanian erkennt anderes: »Ich bin nicht der, der eine Kindheit in Combray hatte – ich bin der, das gelesen hat.« (35) Da sind wir wieder bei der erfolgreichsten Autosuggestion oder erfolgreichsten Simulation: Die Lektüre ersetzt das eigene Erleben. Die Lektüre ersetzt das eigene Leben. Er ist nicht einer, der etwas erlebt hat, sondern er ist einer, der das gelesen hat. Legi et lego, ergo sum.
Diese Identitätsversicherung, die übrigens ganz nahe an den Kernsatz von Handkes Kaspar («Ich möchte ein solcher sein, wie ein anderer einmal gewesen ist«) heranführt, durchzieht den ganzen Text bis an das Ende hin – die Identität läßt sich in dieser Provinz, zu der Österreich geworden ist, nicht gewinnen. Der Ausbruch ist wieder notwendig geworden. Die Reise ins Waldviertel hatte in eine neue Exotik geführt, in eine Fremde, in die nahe Fremde, die deswegen – und das ist das Basis-Paradox des Textes – so fremd geworden ist, weil darin alles so bekannt, so vertraut ist. Wie kaum ein anderer Text in der österreichischen Literatur nach Bernhard bündelt dieser eine Serie von Motiven und Komplexen, die Bernhard auch mit seinen Prosatexten vorgegeben hatte. Er hat ihm übrigens auch in der rhetorischen Figur der Aposiopese seine Reverenz erwiesen: »Es ist alles lächerlich, wenn.« (158) – so heißt es einmal, wobei jeder Leser naturgemäß ergänzt: »Es ist alles lächerlich, wenn man an den Tod denkt.« – ein Satz, den man nicht ohne Grund als den Fundamentalsatz Bernhards ansehen kann, vor allem der Produktion seiner künstlerischen Umspringbilder, in denen einmal etwas als Komödie, ein andermal als Tragödie erscheinen kann. Von dieser Ambivalenz ausgehend, war der Bereich der Simulation zu durchleuchten, mit der Menasse seine Kunstfiguren ausstattet. Daß wir es hier mit Realismus zu tun haben, das wäre so der prima vista-Befund, aber auch nicht mehr. Unangetastet scheint, ich betone: scheint das Prinzip des Erzählens. Alles scheint, ich betone: scheint sich zu einer geschlossenen Handlung zusammenzuschließen. Alles, was der handlungsstarke Roman braucht, wird abundant und doch zugleich mit höchster erzählerischer Ökonomie serviert: Verbrechen und Familie, Zeitgenossenschaft und mythische Distanz, Apokalypse und Technik – sie alle gehen in diesem Text wundersame Liasonen ein. Die Natur als Thema hat ausgedient; die Art, wie sie in diesem Buch verwaltet wird, zeigt an, warum sie als Thema ausgedient hat.
Schubumkehr sollte von der Katastrophe handeln, die als Folge von 1989 aufgetreten wäre. Freilich ist das Schicksal eines so kleinen Dorfes kaum von Belang, aber wie Menasse hier souverän die einzelnen Themen bündelt, die genau durch dieses historische Datum führen, läßt doch immerhin hoffen, daß man auf dem Weg über solche Texte sich eben über diese so beklemmenden Themen verständigen kann. Daß freilich auch nicht alles einer Klärung zugeführt werden kann, daß sich nicht alles rundet, und gewissermaßen einige Ruten von dem so schön geflochteten Korb abstehen, macht das ganze Unternehmen noch glaubhafter: Draußen bleibt der rätselhafte Athamas-Mythos, draußen bleibt irgendwie auch der Tod des unglücklichen Bruno Maria König. Gerade der Verzicht auf solche Abrundungen, die auch ohne weiteres möglich wären, zeigt letztlich den besseren Romancier an, besser in jedem Falle als der, bei dem sich alle Divisionen der erzählerischen Materie ohne Rest auflösen lassen.
Elfriede Jelinek: Die Kinder der Toten (1995)
Dieser vierte umfänglichere Text aus dem Jahre 1995 stellt dem gewöhnlichen Usus des Lesens – vor allem des inhaltsbezogenen Lesens – die größten Schwierigkeiten von allen entgegen, und ich plädiere daher, von jenen vereinfachenden und oft recht platten Leseversuchen abzusehen, wie sie von der Kritik in den meisten Fällen vorgelegt werden. Nicht daß es an Inhalten fehlte – es läßt sich vielmehr von einem Überschuß an Inhalten sprechen, von einem Verschleiß an Motiven und von einer Unzahl von Themen, die anklingen, aber blitzschnell durch andere abgelöst werden, um an ganz anderer Stelle wieder zu erscheinen. Der Text bringt verschiedene Stimmen zu Gehör, prunkt mit einer Fülle von Zitaten unterschiedlichster Herkunft und macht zugleich vergessen, daß er aus dem Stoffe anderer Texte ist, denn jedes Zitat erscheint in einer für ihn spezifischen Funktion.
Den Inhalt haben wir schon oben kurz angedeuetet, und es ist kaum möglich, hier von »Figuren« zu sprechen, obwohl jedoch immer wieder drei angesprochen werden: Edgar Gstranz, ein Untoter aus dem ehemaligen B-Kader der Ski-Nationalmanschaft, Karin Frenzel, lebende Tote und ewige Tochter, getöntes Haar, Brille, ehemals Sekretärin in der Verkaufsabteilung eines Büromschinenkonzerns; Gudrun Bichler, Selbstmörderin und erfolglose Studentin der Philosophie; die Nekropole Österreich als als Sportler- und Urlauberinferno und mehrere Millionen Tote, symbolisiert durch Brillen, Haar- und Menschenheit-Lampenschirmen, die aus allen Bergritzen und Erdspalten hervorquellen. [...] Der Ort: die Pension Alpenrose und ihre schöne Umgebung, Die Zeit: immer. Der Erzähler: ein anonymer Chor, auch »wir langeresehnte Befreier der Toten« genannt. Die Handlung: Katastrophen, Unfälle, Mord und Leichenschändung. Eine nacherzählbare Geschichte gibt es nicht. Die drei Haupttoten, die Seite um Seite immer neue Tode sterben, wie aufgezogene Puppen lustlos Sexualdelikte begehen, einander das Geschlecht zerfetzen, den »üppigen Graspelz« vorzeigen, die »aufgeschwollene Fotze« präsentieren, verschaffen dem Buch immerhin einen personalen Zusammenhang.
In ihrer sehr einfühlsam geschriebenen Rezension scheint mir Iris Radisch jedoch den Akzent zu sehr auf das Moralische zu legen und daher wohl auch das Gesamte zu verfehlen: Der moraline Enthüllungswahn treibt den Roman in einer klappernden Bilder- und Assoziationsuada auf immer steilere Höhen. Unvorstellbar, daß er je ein Ende findet, da der Haß nie seine Objekte besiegt. Mir stellt sich die Frage, ob die Kategorie »Haß« in diesem Zusammenhang auch sinnvoll angewendet werden kann. Für Iris Radisch bleiben daher nur »mittelmäßige Sprachspiele«. (ebda) Gerade hier möchte ich einhaken: Die Frage, wie denn exzellente Sprachspiele auszusehen hätten, stellt sich an dieser Stelle doch. Denn gerade daß das Triviale, der Kalauer nicht verschmäht wird, gerade dadurch, daß Anleihen bei den Trivialmythen (Wiedergänger, Vampire) und bei den Mythen des Alltags genommen werden, gerade dadurch, daß jedes Motiv durch diese Kalauer durchlässig für ein anderes Motiv werden kann, daß durch das Sprachspiel immer auf ein neues Thema angespielt und ein neues Motiv eingespielt wird, erhält der Text eine Dynamik, die weit über scharf konturiertes Erzählen hinausreicht, über ein Erzählen, in dem es auf die Vorgänge und auf sonst nicht eben viel ankommt. »Sperrig und abweisend« nannte Sigrid Löffler in ihrer Rezension dieses Gebilde.
Wer sich nun die deutliche und klare politische Botschaft erwartet, die man in eine analytische Sprache übersetzen könnte, der wird enttäuscht abziehen müssen. Mir geht es in der Folge doch darum zu zeigen, daß hier Qualitäten vorliegen, die eben jene Verfahren aufbrechen, in die sich die Österreich-Kritik – sehr zu ihrem Schaden – eingeschnürt hatte. Das Verfahren Elfriede Jelineks (*1946) wird so – gewiß nicht der Aussage nach – zu einem Gegenstück zu dem Haslingers, Menasses und Ransmayrs. Was hier vor uns abläuft, bedient sich der Mittel des Horrorfilms: Die Visagen jener seltsamen Gestalten verflüssigen sich plötzlich, nehmen ihre Körperteile in die Hand, fallen wie Puppen auseinander, sind Kunstfiguren, die nur als solche überleben können. Es geht nicht darum, den Österreichern (und Deutschen) vorzuwerfen, sie wären mit der Vergangenheit sorglos umgegangen und hätten sie verdrängt; es geht vielmehr darum zu zeigen, in welche Bilder sich das fassen läßt, was die Vergangenheit uns aufgebürdet hat und wie wir damit umzugehen gezwungen sind oder uns gezwungen fühlen. Es ist auch nicht eine einfache Inversion von Mythen, wie man annehmen könnte; entscheidend ist, wie eine solche Inversion betrieben wird. Auf ein Beispiel hat Juliane Vogel in ihrer Besprechung in den manuskripten besonders aufmerksam gemacht: Es geht um die Zeugung eines Kindes – durch Vergewaltigung, aber nicht dadurch, daß der Mann die Frau vergewaltigt, sondern umgekehrt:
Karin zahlt [...] alles heim, was Frauen seit den Untersuchungen an Mädeln, seit Lust im Auto hinnehmen mußten: in einem brutalen Solo bringt sie einen sportiven BMW-Besitzer in ihre Gewalt. [...] In einer zweiten Begegnung zwischen Opfer und Täterin wendet sich der mörderische Vorgang in sein Gegenteil. Der Mord an dem Autofahrer liefert die Grundlage für eine neue und künstliche Zeugung. Ein neues »Kind der Toten« wird geboren. Es beginnt eine Jelineksche Weihnachtsgeschichte.
Das ist nur eines der vielen Beispiele, wie Jelinek verschiedene und oft recht heterogene Vorstellungen miteinander zu verknüpfen versteht: Hier die katholische Liturgie, dort ihre satanische Parodie. Der Satanskult, das Okkulte bestimmt die Sprachkultur des Textes. Es geht hier auch darum, das Klischee zu aufzubrechen, demzufolge die Frau dazu verurteilt ist, fröhlich bis an ihr Lebensende Gebärfreudigkeit zu verkörpern und somit Natur, ungebändigte Natur und doch immer aufs neue zu bändigende, zu sein. Doch wäre es nicht angemessen, die Brisanz dieses Textes mit dieser feministischen Botschaft allein zu umreißen:
Bei alledem wird in einer beispielosen Engführung Geburt und Tod kontaminiert und zwar in beständiger Rücksicht darauf, daß die alten menschlichen Erfahrungen des Sterbens und Geborenwerdens dem Menschen entwendet sind, um von den großen Tötungslabors der Konzentrationslager bzw. den Geburtslabors der künstlichen Befruchter und der Gentechnokraten gesteuert zu werden.
Die thematischen Zentren sind freilich für die Analyse von großer Bedeutung, vor allem aber die ständige Verknüpfung des Entlegenen in unserem Bewußtsein. Die Sprache zwingt verschiedene Komplexe zueinander und ermöglicht so eine Synthese, die unsere Gewohnheiten weit übersteigt. Ich möchte hier wieder von dieser zeugmatischen Praxis sprechen, mit deren Hilfe das, was wir für den Alltag trennen, ja trennen müssen, in der Poesie verbunden scheint. Die Paradoxie ist durch das Prinzp des Wiedergängers, durch die vampirische Grundthematik gegeben; in dem Ausdruck »die Untoten« wird ein Euphemismus in sein böses Gegenteil gekehrt: Diese »Untoten« sind schlimmer als die Toten, weil sie ein Leben führen, das vom Tode bestimmt ist.
Entscheidend für uns ist das Verfahren: Ich hatte den Eindruck, daß man diesen Text der Elfriede Jelinek nahezu von jeder Zeile aufs neue betreten kann, daß jeder Satz in Beziehung zu diesem Zentrum des Todes und der Verwesung steht. Jelineks Erzählen ist ein Erzählen von Veränderungen, von Wandel und Verwandlung: Das Prinzip der Metamorphose bestimmt durchgehend den Text, es ist, als ob sich alles auflöste, seine Gestalt nicht behalten könne oder wolle, aber dann doch wieder von der Sprache in einem bestimmten Status fixiert werde. Es geht vor allem aber um das Fließen, um das Rinnen, es sind »Fließtexte« könnte man sagen – auch hier gibt es das große Vorbild in den Metamorphosen des Ovid, ich denke dabei vor allem an die Geschichte der Cyane, die Pluto, der mit seiner Beute Proserpina der Unterwelt zueilt, aufhalten will: Da wird sie, die Quellnymphe, zu dem Wasser, das sie in ihrer göttlichen Existenz repräsentiert: Eine furiose Verwandlung, die uns jene eigentümliche Modernität des Ovid-Textes anschaulich macht, die uns an Bilder von Dali erinnert, aber auch an Partien aus Jelineks Roman. Hier verflüssigt sich etwas, wie auch im Roman der Elfriede Jelinek. Eine Stelle kann als schlagende Parallele angesehen werden: Ein junger Mann und Grudrun Bichler, die Untote, kommen zueinander: Der junge Mann hat inzwischen ebenfalls abgelegt, er hat sich in den Gatsch seiner Kleidung gesetzt und beschmiert sich damit. Wie Wasser fällt das Fleisch Gudruns über ihn, in diesem Teich plantscht er ein wenig herum, sein Spieltier hüpft auf den Wellen, aber es fährt doch jedesmal tapfer ein und wieder aus.
Geschlechtsverkehr im Gestaltlosen. Nur steht dieser Verflüssigungsvorgang im Zeichen der universalen Katastrophe, der Sintflut, steht unter einem apokalyptischen Zeichen; Man denke vor allem an die Schlußpatie, (617). »So kündigt sich der alte Vernichtungsmythos der Sintflut in einer sendefertigen Wetteransage an,« hat Juliane Vogel formuliert, und eben dieses Aufeinanderprallen der Jargons macht auch den prekären Reiz dieser Prosa aus. Wir erkennen auch hier den Zusammenhang mit der Lust an der Metamorphose gerade in den Texten des ausgehenden vorigen Jahrhunderts, eine Lust, die weit größer ist, als daß sie zulässigerweise als modische Erscheinung bezeichnet werden könnte.
Die Sprache selbst wird zu so einer Sintflut, die sich über den Leser ergießt, die ihn, wie die Toten und Lebenden unter sich begraben zu scheint. Die unheimliche Mimesis dieses Textes beruht darin, daß er das nachahmt, was als naturhafter Vorgang in dem Werk selbst beschrieben wird: Die Sprache ist Müll, und dieser Müll ergießt sich als Mure (DIE MURE. DIE FURIE. (655) – man beachte die assononierende mythologische Überhöhung der Mure, der Naturkatastrophe, ihre Gestaltwerdeung in einer menschlich-unmenschlich aussehenden Gottheit.). Man muß die einzelnen Stellen mit der größten Aufmerksamkeit lesen, denn in nahezu jeder steckt so eine verborgene Mechanik des Unheils, zugleich aber auch eine zeitkritische Diagnose, die sich gewaschen hat. Über Österreich: »Dieses Land hat immer stillgehalten, das heißt, es hat Stil, es erforscht Menschen grundsätzlich erst, wenn sie schon in den Mistkübel fliegen.« (16) Ich habe schon des öfteren den Müll als eine zentrale Chiffre für die Literatur der neunziger Jahre zu fassen gesucht: Der Müll und der Tod aber sind unser Eigenes, die finden sich zuverlässig ein, wo auch wir dahintreiben auf dem schmutzigen stinkenden Wasser, auf dem wir und unsere Abfälle schwimmen und auf jenen Tunnel dort zutreiben (die zerbrochene Hülle unseres ehemaligen Hauses), durch den heute die U-Bahn rauscht. (303)
Das Fleisch ist Aas und das Unheimliche, das uns befallen sollte, wenn wir an Fleisch denken, das so ist, wie wir, das wird an diesen Stellen noch und noch verstärkt, vor allem an der Stelle, da der smarte BMW-Fahrer Opfer der Vergewaltigung durch Karin Frenzel wird: »In diesem BMW ist jetzt durchdringlich Fleisch zu riechen, nicht als Aas, sondern es ist der warme, fade, geschwollene Fleischgeruch, der vom Fleischstab des Moses kommt [...]«. (330)
In diesem Text ist, wie schon mehrfach betont, die zeitliche Sukzession suspendiert. Das ist für unser Bedürfnis nach einer Achse, an der wir die einzelnen Textsegmente befestigen wollen, in schöner Ordnung befestigen wollen, problematisch: Es wird uns schwer gemacht, aber wir müssen erkennen: Wir sind drinnen in der Zeitlosigkeit: »Edgars Aufbrechen soll sich vor dem, was da in endlos dunkler Wolke auf ihn zukommt: der Zeitlosigkeit! verwahren.« (34) Man beachte, wie Jelinek die Bilder gleich weiterspinnt und die Figur zwischen Tod und dem Leben als Untoter balancieren läßt, wie sie den von der Natur aufgefressenen wieder zur Gestalt macht, nur um ihn diese wieder erneut verlieren zu lassen. »Es ist jeder Tag derselbe Tag« heißt es gleich darauf, um mit einer Hölderlinschen Wendung weiterzugehen: »am Abend enden still die Gedanken«, die dann wiederum ironisch aufgefangen wird mit der Sequenz: »nur um am nächsten Morgen wiederzukehren, unversehrt, ungeklärt, aber von Gudrun wieder mal tüchtig gequält und geschunden.« (36)
Die Menschen sind offenkundig darauf eingestellt, die anderen zum Müll werden zu lassen: »Karin Frenzel hat ihre Mutter im Müll der Gartenmöbel deponiert, damit die alte Frau von der Landschaft ein wenig geprägt werden kann, doch der Stempel drückt in ein längst eingetrocknetes Kissen.« (76) Es lohnt sich, diese einzelnen Versuche, Gestalten, die zum Zerfall, zur Gestaltlosigkeit verurteilt sind, in ihrer sinnbildhaften, allegorischen Präsenz deutlich nachzuzeichnen. Die spontane Allegorisierung überzieht den ganzen Text, immer wieder sind es solche Sinnbilder, die im Text dann eine erklärende Unterschrift erhalten, die oft in einem ironisch gespannten Text zu dem Bildinhalt steht. Auch vor mythologischen Metaphern macht der Text nicht halt, wenngleich keinesfalls aufdringlich – es ist eine dezente Deutlichkeit, mit der diese Bilder vorgegaukelt werden. Was paßt besser in eine solche Alpenlandschaft als ein Jagdmythos, und welcher Jagdmythos ist zugkräftiger als der des Aktäon, der Diana im Bade überrascht, von ihr – wegen der vermeintlichen Neugier – in einen Hirsch verwandelt und von seinen eigenen Hunden zerrissen wird? Wieder einer der so wichtigen und so geglückten ovidischen Verwandlungsgeschichten. Bei Jelinek wird etwas anderes daraus: Wir sind plötzlich in Lainz, damals und lange Zeit mit einem wenig guten Leumund bedacht. Wer nicht genau hinschaut, wird nur Lainz und die mordenden Krankenschwestern sehen, wer genauer liest, erkennt dahinter die umerzählte Aktäon-Geschichte, ohne daß der Name Aktäon auch nur einmal fallen müßte (232f.) – ein Motiv, das an ganz anderer Stelle später wiederkehrt: »In des Hirsches Gestalt plagt sich Gudruns Seele, beherrscht als eine Beute des Todes.« (553)
Ich kann hier unmöglich auf die vielen Anspielungen eingehen, mit denen Jelineks Text sich von anderen Texten speist. Diese Fähigkeit, von überall her Nahrung zu beziehen, erzeugt denn auch die Stimmenvielfalt – die auch des Philologen Lust sein kan. Es gibt kaum einen Text, in dem das Prinzip des Recyclings so konsequent in einer geradezu großindustriellen Organisation vorgeführt wird: Der Sprachmüll wird neu aufbereitet. Wir müssen mit dem, was wir produziert haben wieder zurande kommen. Wir müssen daraus etwas Neues herstellen, wir müssen umarbeiten können. Im Recycling steckt ja das Wiederholsame schon drinnen, und es ist so, als ob alle diese Texte (wie auch seine Figuren) unter einem unheimlichen Wiederholungszwang stünden: »Edgar ist zumute, als erlebte er etwas, das bereits stattgefunden hat, ein zweites Mal, in einem Wiederholungszwang, wie eine Melodie, die einem nicht aus dem Kopf gehen will.« (189) Es ist, als ob dieser Text die Vorlage für unzählige Videoclips sein wollte, in denen sich auch immer dasselbe abspielt, die den Blick auf keinem Bild, auf keiner Szene ruhen lassen, sondern jählings umspringen und abspringen. Eine Welt des Häßlichen, des Ungeformten, durch die wir hindurch müssen, eine Welt der Unsicherheit der Wahrnehmung, die uns immer wieder auf Häßliches zurückwirft.
Die Avantgarde und ihre neuen Spielarten
Ernst Jandl
Eine Vorlesung über die Literatur der neunziger Jahre in Österreich muß auf Ernst Jandl (1925-2000) eingehen: Zwar blieb er für die meisten der Sprachkünstler und Experimentator, wie er sich in den sechziger Jahren dem Publikum präsentiert hatte, doch trat mit der Mitte der siebziger Jahre ein entscheidender Wandel in seinen Texten ein: Das Ich, das aus der (sogenannten) experimentellen Literatur verbannt zu schien, kehrte wieder, und zwar als ein beschädigtes. Seit den Gedichtsammlungen die berabeitung der mütze (1976) und der gelbe hund (1980) begegnet uns dieses Ich zusehends als ein leidendes, ein entstelltes Ich, als ein Ich, das sich dem der Verfall des Körpers zusehends bewußt wird. Das wird in porträt des schachspielers als trinkende uhr (1983) noch radikaler.
idyllen (1989)
Am deutlichsten manifestiert sich dieser Verfall aber in den idyllen von 1989. In diesem Zusammenhang sei besonders auf das Gedicht älterndes paar. ein oratorium eingegangen. Doch vorweg einiges zu dieser Sammlung, deren Titel natürlich nur ironisch zu verstehen ist. Daß indes dem deutschen Schulverstande es doch möglich ist, diese idyllen ernsthaft als Idyllen im landläufigen Sinne zu verstehen, wird durch einen der absurdesten Beiträge zu Ernst Jandl demonstriert, der wohl je erschienen ist, und zwar durch den Aufsatz von Christoph Zeller, der allen Ernstes behauptet, daß sich Jandl an die Idyllentheorie Jean Pauls gehalten habe und die Tradition der bukolischen Dichtung von Theokrit über Vergil bis in die Gegenwart fortsetze. Hier findet sich auch die abenteuerliche Auffassung, daß eben das Ich nicht wiedergekehrt sei, sondern nur vernichtet werde usw. Jandl selbst zeigte sich durch diese Auffassung höchst befremdet – er hatte Jean Paul nicht gelesen, wie er bedauernd zugab. Freilich ist nicht der Dichter die Instanz, von der allein die Informationen zu holen sind, so lange dies aber möglich ist, tut man immer gut daran, mit den Autoren ins Gespräch zu kommen. Ein Rückschluß auf die Tradition der Idyllen-Dichtung läßt sich nur in der Form Negation durchführen – hier wird die Idyllen-Tradition völlig gelöscht. Der Tenor der Gedichte ist für die meisten Kritiker eindeutig: Was diese »Bildchen«, diese Gedichte und Sprüche aus den Jahren 1982 bis 1989 zeigen, ist Entfremdung, Einsamkeit, Hoffnungsschwund, das Körperliche in seiner Hinfälligkeit, Unappetitlichkeit und Obszönität; lediglich eine einzige, freilich auch durch die Trauer des Verlustes gefilterte Kindheitserinnerung stellt da eine kleine Ausnahme dar.
Daß hier Komik und Tragik ganz eng beieinander liegen, wird ebenso einmütig festgestellt: Der »Depressionshumorist« würde in dieser »heißen Lyrik« das »abgrundtief Komische« mehr denn je hervorkehren. Die idyllen seien daher in dieser Ambivalenz des Komischen und Tragischen ein Höhepunkt: »Der finstere Witz, den die Sprache da baut, umrankt kräftiger sprießend denn je des Autors Weg.« Schließlich ist es die immer derbere Sprache, die sich nicht scheut, die Dinge auch bei ihrem vulgärsten Namen zu nennen und so auch dem Anstößigen nicht aus dem Wege zu gehen: »In diesem Buch finden sich drastisch-obszöne Texte, die freilich nichts zu tun haben mit der billigen Sucht, den Leser zu schockieren.« Die Erfahrung von Krankheit und Älterwerden wird schonungslos angesprochen. Für Jörg Drews besteht das »Jandlsche Programm« darin, »alle Euphemismen erbarmungslos zu zerstören«, was aber – bezeichnenderweise in Österreich – sofort im Zusammenhang mit der Vanitas-Tradition gesehen wird: »Vergänglichkeit tritt barock auf, benachbart der Brechung naiven Glaubens katholischer Tradition. Der Tod reicht handfest ins Leben.« Daß diese idyllen nicht Idyllen im landläufigen Sinn sind, ist im vorhinein klar: Da ist »nichts Bukolisches« und da ist nichts vom »Vollglück in der Beschränkung«, von dem Jean Paul einst sprach, vorhanden, denn die Natur, die es bei Jandl – naturgemäß – zwar »reichlich gibt, hat immer das, was den Städter an ihr stört, und sei es nur, daß sie in sticht oder zwickt.« Man könne sie nur im Wortsinne als »Bildchen« verstehen wogegen aber doch die Einsicht steht, daß gerade in diesem Gedichtband »schonungslose Metaphernabsenz« herrsche.
Inhalte und Themen sind in der Kritik meist übereinstimmend benannt worden, und was gesagt wurde, ist auch kaum Anlaß für Kontroversen. Schwierigkeiten und Divergenzen ergeben sich allerdings in der Beurteilung der von Jandl angewendeten Technik. Da in ihr gerne und unausgesetzt der Sprachexperimentator vermutet wird, ist denn auch die Beschreibung der Methoden einigermaßen divergent. Allgemein erkannt man, daß »Sprach- und Wortwitz« zurücktreten würden, »aber niemals ganz«, doch »die Vermittlung von Empfindungen, Gefühlen, Stimmungen« würde nun vorrangig; nun sei der »Blick vom Partisanen der Sprache auf den Menschen Jandl zu richten.« Die Mittel, mit denen Jandl an der Wende von den siebziger zu den achtziger Jahren das beschädigte Ich zur Sprache zu bringen suchte war »die beschädigte Sprache«, die in den idyllen jedoch nicht mehr so häufig auftritt. Die Paradoxien des Lebens und der Welt, die im experimentellen Sprachspiel immer einen artifiziellen Charakter gewannen und nie ganz diese hergestellte Künstlichkeit verleugnen konnten, zeigen sich nun selbstverständlicher, unbezweifelbarer.
Das älternde paar stellt den nachhaltigsten und bösesten Widerruf jeglicher Idylle dar: Was sich sonst als Philemon und Baucis von Ovid bis Goethe als Gegenstand partnerschaftlichen Verhaltens und gemeinsamen Alterns in Würde verstand, wird hier völlig zerstört. Noch dazu scheint die Kennzeichnung »Oratorium« dem Ganzen so etwas wie eine sakrale Weihe zu geben. Und es schimmern auch immer noch Reste eines erhabenen Stils durch, die sich zwischen den an keiner Derbheit sparenden Zeilen wie Oasen des Glücks ausnehmen, wie das lyrische einer Sprache, die an Shakespeare, John Donne und die anderen erinnert und die versunken ist wie Atlantis: »Ja, liebe, wie sie diese zwei erfaßt, ist haut und fleisch, gehäuse, kern und saft.« Dazu gehört auch die Reminiszenz aus der Bachschen Matthäus-Passion: »wir setzen uns mit tränen nieder;« die dann ihre Fortsetzung in der schönen Zeile findet: »flieder/duft drückend sich schlägt aufs gemüt.« (Jandl 1989, 123). Zum »dirty old man» gesellt sich das »dirty old wife», völlig verzweifelt. Die Sprache läßt an Deutlichkeit in Bezug auf das Fäkalische und Sexuelle nichts zu wünschen übrig. Was sprachlich sich nur in der Form des Euphemismus in die Sprache unseres Alltags hinüberwagt – hier wird es Ereignis, grausames Sprachereignis. Diese Deutlichkeit, die ihre Energien nicht zuletzt aus dem Kontrast von Obszönität und gehobener Sprache bezieht, ist ein Kennzeichen der Literatur der neunziger Jahre: Hier ist keine Identifikation mehr möglich – wir rücken ab von diesem Paar, wenn es sich zu uns auf die Gasthausbank setzt. Aber eben dieses Abrücken wird Gegenstand des Gedichts, und wir werden uns fragwürdig, so verständlich unser Abrücken auch sein mag.
stanzen
Noch radikaler ist Jandl in seinen stanzen verfahren, die versetzen den Leser in eine ganz andere Umgebung: Hier hat ein Autor einen neuen Zugang zur Poesie gefunden und darüber auch genau Auskunft gegeben: »mitte august 1991 [...] gelang es mir unversehens, einen motor anzuwerfen, der für eine gewisse zeit eine kontinuierlich rapide gedichtproduktion ermöglichte, wie ich es in meiner schriftstellerischen mehrmals erlebt hatte, [...].« Maßgeblich dabei waren die »gdschanzln«, die der Autor als kleines Kind (bis etwa 1929) bei Bauernfestlichkeiten in Niederösterreich gehört hatte:
Spontanproduktionen im niederösterreichischen Dialekt, die sich ihm eingeprägt hätten. Jandl hat nun die meisten dieser Gedichte im Dialekt geschrieben, wobei der Wiener Dialekt die Grundlage abgibt, aber freilich ist dies keine Mimesis eines bestimmten Dialekts. Die Wahl dieses Mittels ist eben auch Ausdruck dieser »Realisation von Freiheit«, die Jandl begründet wie folgt: »es ging nicht an, eine normierung des dialekts zu erstreben, wo zu den poetisch nutzbaren vorzügen dieser art sprache gerade ihre ungenormtheit zählt.« (Jandl 1992, 142) Schließlich distanziert sich Jandl von jeder Wirkungsabsicht, die diesen Texten unterstellt werden könnten, sei sie therapeutischer, anthropologischer, psychologischer oder religiöser Natur – es sei »ein buch poesie [...], ein buch erhebender und niederschmetternder sprachkunde, und nichts sonst.« (Jandl 1992, 144) Die Schwierigkeiten mit gerade diesem Buch ergaben sich für die Kritik vor allem aus der Tatsache, daß diese Beispiele von »sprachkunde« nicht auf einen thematischen Nenner zu bringen waren, wie dies mit den idyllen doch noch möglich zu sein schien. Es seien »Vierzeiler, die nicht leicht zu durchschauen sind«, »Augenblickspoesie«; immerhin würden sie sich zu einer Art Lebensbilanz zusammenschließen. Man erkennt die Themen wieder, die Jandls späte Werke bestimmen:
Viele von Jandls stanzen sind vierzeilige Zoten ohne Erotik, aber mit detaillierter Liebe zu Körperöffnungen und Ausscheidungsprodukten [...], Texte, die resignierend oder schadenfroh den Verlust der Potenz, die Alarmzeichen des Alters, die verzweifelten Liebesversuche und Ersatzformen thematisieren, und auch immer wieder die Angst und den Tod. Und von der Verwendung des Dialekts aus ist am ehesten die provokante Funktion dieser Texte zu erklären. Für Scharang ist der Dialekt ein Mittel, das noch dazu tauglich ist »den Schorf aus Politiker- und Journalisten- Kauderwelsch vom Fleisch der Sprache abzuheben«. Jandl hätte zum Dialekt gegriffen, ehe dieser wieder »zurückgepfiffen« werde »an den Stammtisch, um den um Brot und Geist Gebrachten den falschen Trost zu suggerieren, sie hätten, wenn schon sonst nichts, so immerhin noch eine Heimat in der heimatlichen Sprache.« Während ein Dialekt, der als Ausdruck des Heimatlichen, des Vernakulären verstanden sein will, seine Rede freundlich einkleidet und die Konversation mit Euphemismen bedient, bewahrt Jandls Kunstdialekt »gleichermaßen das dumpfe Brüten, ja die Brutalität der Mundart, aber auch ihren schlagenden Witz.« Jandl konzentriere sich auf »nicht domestizierte Wörter, vor deren Inhalten die Hochsprache einen Bogen schlägt, um seine, Jandls, Unversöhnlichkeit mit der Welt zu fassen.« Der Dialekt ist durchaus nicht simpel, sondern »vielmehr eine sehr elaborierte, musikalisch reiche Redeweise mit lebendigen, nicht durch Bildungsanspruch erzwungenen Konjunktiven.« Nur aus einiger Entfernung können solche Töne so konsumiert werden, als wären sie eine Wiener Angelegenheit, oder – und dies ist eines der kuriosesten Mißverständnisse in der Jandl-Rezeption – als eine »typische Lehrer-Idee« Jandls, der seine Gedichte von den Schülern »erarbeitet« sehen wollte. Gerade solche Ansinnen werden in dem präzise formulierten Nachwort unterbunden, und auch die Nähe zur Dialektdichtung der Wiener Gruppe ist nicht gegeben, und Jandl ist ebensowenig Artmann wie dieser Weinheber ist: Jandl ist nicht darauf aus, in seinen Texten diese Bildlichkeit zu beschwören, die Artmann in seine Dialektgedichte investierte. Eine differenzierte Ansicht der Funktion des Dialekts hat Franz Josef Czernin vorgelegt:
Das Schimpfen, das Ungehobelte, das Grobianische und überhaupt jegliche Drastik sprachlichen Ausdrucks werden häufig als Anzeichen für das Unterschichtige oder Unkultivierte angesehen, umgekehrt wird der Dialekt als das Anzeichen für das Unterschichtige und Unkultivierte, häufig auch für etwas Ungehobeltes, Grobianisches und wohl auch Schimpfliches gehalten. Wenn also nun, wie in den stanzen, beides zusammentrifft, das Schimpfen wie auch der Gebrauch des Dialektes –dann schließt sich ein solches zweifach niedriges Sprechen nach traditionellem (sowohl vormodernem als auch alltäglichem) Verständnis beinahe selbstverständlich von der Lyrik, einem der beispielhaften Fälle des Kultivierten und Hochsprachigen aus; ja, ein solches niedriges Sprechen ist das, wogegen sich die sogenannte hohe Literatur oft abgrenzt oder wenigstens abgegrenzt hat (denn die Moderne mag da die Maßstäbe einigermaßen verändert haben).
Der Dialekt garantiert auch den Qualitätssprung. Die Unsicherheit der Kritik resultierte nicht zuletzt daraus, daß in dieser vermeintlich banalen Einkleidung jede triftige Aussage suspendiert schien; mag auch in vielen Texten jede Form von Kausalität aufgehoben und die Vermutung, es handle sich um Unsinnspoesie oder Kalauer gar nicht unangebracht sein, so gibt es doch manche stanzen, die in epigrammatischer Zuspitzung sehr wohl auf manche fatale Dialektik hinweisen und zeigen, wie das falsche Denken von einst auch das falsche Denken von heute ist: »d'oide antisemitin/waa no heit gean a jiidin/dos sogn kennt: schauz mi aun/d'nazi hom uns nix daun.« (Jandl 1992, 17 ) Und hin und wieder tauchen in diesen Texten auch Fremdkörper auf, manche sind von englischen Sprachbrocken durchsetzt oder zur Gänze auf englisch; anderen wiederum ist auch der belebende Kontrast von Dialekt und Hochsprache eingeschrieben: »es schdinggadn weiwa/bin ned aicha raiwa/bin a ogrissna hund/meine seele gesund.« (Jandl 1992, 35) Mit den – aus dem Kontext übrigens schwer erklärbaren Worten »meine seele gesund« – ist eine Ablagerung aus der Sprache der katholischen Liturgie zu finden, mit der Jandl übrigens auch sein Gedicht das schöne bild (Jandl 1995, Bd. 2, 633) abgeschlossen hatte. Doch so wird die Seele nicht gesund, und der Körper auch nicht. Immer wieder ist von dessen Defiziten die Rede, aber Heil und Gesundheit flehen diese Verse nicht herbei. Und in dem einzigen Gedicht, das zur Gänze hochdeutsch gehalten ist, erscheint der Sprecher in Menschen- wie in Tiergestalt: »noch sitz ich fest/in letzter lebensphase/ein mensch, ein wenig hund/ein wenig hase.« (Jandl 1992, 82; vgl. Jandl 1989, 140: »ich sein hund in hasen.«) Drei verschiedene Existenzformen sind ineinandergelegt, und es liegt wohl am Menschen, daß er »noch ein wenig dichterlich« (Jandl 1989, 101) wirken kann, aber er wäre das nicht, wenn er sich nicht so wie Hase und Hund, wie Gejagter und Jäger fühlen könnte, aber den Verlockungen, die stanzen aus ihrer outrierten Banalität in Gefäße des Tiefsinns zu gießen, verwehrt der Dichter mit dem überzeugenden Verdikt seines Nachworts.
Kein Gedichtband Jandls ist formal in sich so geschlossen und homogen wie die stanzen, keiner macht mit ähnlicher Entschiedenheit Ernst mit dem Bekenntnis zur Banalität, auf der der Autor immer wieder insistiert: So seien seine stanzen letztlich nichts anderes als »a glaana/literarischer schmäh.« ( Jandl 1992, 128) Die Betonung des Bagatellcharakters warnt gewiß vor einer Überinterpretation, sie macht aber zugleich darauf aufmerksam, daß die ästhetische Leistung in der Ballung komplexer Zusammenhänge auf kleinstem Raum besteht. Auch hier geht es doch – wie es zu Beginn der idyllen bereits angeklungen ist, um die prekäre Situation des Schriftstellers. Prägnant erfaßt diese eine Stanze, die für den die Sammlung abschließenden Zyklus zur eröffnung des literaturhauses in wien am 30. September 1991 geschrieben wurde: »singan kauna no ned /brauchd east a faust in d goschn, / n tritt in d eia [Hoden] /singd nocha wia r a nochdigoe/und de kiwara boschn[die Polizisten klatschen].« Mit Tritten wird der »wahre Vogel« zum Singen gebracht, eine Strophe, die durch ihre Deutlichkeit viel über die Situation der Literatur in unserer Gegenwart zu sagen vermag.
Ferdinand Schmatz: das grosse babel,n (1999)
Leider kann im Rahmen dieser Vorlesung nicht mehr auf die so bedeutende Rolle der Avantgarde in Österreich in einem Umfang eingegangen werden, der der Sache auch gerecht würde; zum anderen muß doch darauf verwiesen werden, daß das, was die Wiener Gruppe in den fünfziger Jahren begann, was von Ernst Jandl und Andreas Okopenko versucht wurde, was sich im Aktionismus und in der Happening-Kultur niederschlug, was von den Grazer Autoren in den späten siebziger Jahren fortgesetzt wurde, nicht ohne Folgen blieb, und daß viele Autoren eben diese Tendenz fortsetzten. Hier ist vor allem ein Autor zu nennen, dessen Bedeutung und dessen literarische Leistung nicht überschätzt werden kann: Reinhard Prießnitz (1945-1985), der nur wenig schrieb, zu dessen Lebzeiten kaum etwas veröffentlicht wurde, vor allem seine vierundvierzig Gedichte (1979). Prießnitz war eine der wichtigsten Anreger; seine theoretischen Leistungen bedürfen einer eingehenden Darstellung. Wichtig wurde Prießnitz vor allem für zwei jüngere Autoren, und zwar für Franz Josef Czernin (*1952) und Ferdinand Schmatz (*1953). Auf ihre Werke wäre in einem anderen und größeren Zusammenhang einmal etwas genauer einzugehen. Wichtig war hier für auch vor allem Heimrad Bäcker (*1925), der die edition neue texte in Linz herausgab, wo die radikalen österreichischen Avantgardisten eine Publikationsmöglichkeit bis in die achtziger Jahre hinein fanden. Ich kann auf die Zusammenhänge nicht eingehen, doch scheint mir wesentlich, daß Schmatz und Czernin ihre Verfahren konsequent weiterentwickelten und neue Möglichkeiten des Schreibens jenseits der publikumswirksamen mimetischen Literatur suchten – ihr Versuch, einen klassischen Grubenhund zu erzeugen und gute schlechte Gedichte zu machen, die sämtliche Klischees der Gegenwartsliteratur herbeizitierten und so dem Residenz-Verlag schlicht ein Machwerk unterzujubeln, das der Cheflektor hervorragend fand, hat 1987 auch Literaturgeschichte gemacht. Ich wende mich nun einem Versuch von Ferdinand Schmatz zu, in dem er das Wort der Bibel als Herausforderung nimmt. Was darin mit der Bibelsprache geschieht, mag auch als Herausforderung verstanden werden. Auf jeden Fall ist es schwer, eine inhaltlich gebundene Interpretation dieses Werks zu geben. Man muß sich auf das Verfahren von das große babel,n einlassen, enthält es doch eine Sprachkritik, die sich von naiv gesellschaftskritischen Pointen entfernt und damit just das erreicht, was die sogenannte gesellschaftskritische Literatur nicht erreicht. Es ist ein Text, der vom Wort her lebt, und was aus dem Wort geworden ist, das sieht man, wenn man dem Text Schmatz' die Einheitsübersetzung gegenüberstellt, die er dem Buch beigefügt hat.
Daß das Wort in unserer Kultur so wichtig ist, das geht zu einem guten Teil auf die dominante Rolle der Bibel zurück: Das Wort, das im Anfang war; das Wort, das Fleisch geworden ist; das eine Wort, das meine Seele gesund macht; seine Worte, die nicht vergehen werden, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Die Handlungen im Alten wie im Neuen Testament sind Handlungen, die über das Wort laufen: Der Herr, der spricht, daß Licht sein solle, die Klagen Hiobs, die Worte, die der Psalmist an Gott richtet. Was liegt näher, als das Wort beim Wort zu nehmen, und Ferdinand Schmatz hat das mit seinem das große babel,n getan: Man lasse sich durch die Schreibung des Titels nicht verwirren: Zwischen dem l und dem n des »babel,n« steht ein Komma, ein Signal der Verwirrung, die sich beim Turmbau von Babel ergab und die dem Buch den Titel gab: »Dort hat Jahwe die Sprache der ganzen Erde verwirrt, und von dort hat sie Jahwe über die Erde zerstreut,« heißt es in der Einheitsübersetzung. Sie enthalten die Texte, auf die sich seine Bearbeitung bezieht: Die ersten siebzehn Kapitel der Genesis, grob gesprochen also von der Weltschöpfung bis zu Abraham, einige Psalmen und die Apokalypse des Johannes. Das Verfahren, mit dem sich Schmatz der Heiligen Schrift nähert ist nicht Paraphrase, aber auch nicht Parodie und schon gar nicht Umdichtung oder Nacherzählung. Überhaupt ist das Erzählerische, was doch den Grundton der Genesis ausmacht, aus dem Text draußen: »Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde« – dieser wuchtige Uranfang der Urerzählung – gerät bei Schmatz zu dieser Folge tönender Worte: »nichts,/dass alles/ringt sich,/achsengebeugt,/im wehdrang klagbar hoch« - die Weltschöpfung aus dem Nichts ist zu erkennen, doch sich auf das Inhaltliche festzulegen, hieße das Spezifische dieser Leistung verkennen. Diese besteht darin, daß Schmatz' Sprache anhand der Vorlage auf differenzierte Weise produktiv wird. Da macht sich niemand lustig über die Erhabenheit oder stellt diese Erhabenheit in neuer Inszenierung in seiner Sprache nach. Es wird auch den großen Worten der Überschuß an Bedeutung nicht herausgetrieben, viel eher werden die prallen Wortsäcke durch die scharfen Messer der Sprachspiele aufgeschnitten, denn wir wissen: Die Sprache ist verflixt und zugenäht. Am gelungensten scheint mir dieses Sprach Ping-Pong zwischen Bibel und Schmatz in den Abschnitten zu sein, die der Offenbarung des Johannes gewidmet sind. Ein Beispiel möge genügen, um vom raffinierten Umgang mit den großen Bedeutungen einen Eindruck zu vermitteln: Bei Schmatz setzt die Apokalypse mit folgenden Worten ein: »um offen, und das bar, zu sein,/ist auch verschlossenes von nöten.« (97) Das ist Sprachphilosophie in einer Nuß: Wenn es um Offenbarung geht, muß es auch ein Verborgenes geben, dessen Offenbarung sich lohnt. Wenn Worte einen Sinn haben, den es zu offenbaren gilt, so muß es auch einen verborgenen Wortsinn geben. Mir schien es manchmal, als würde dieser Text Schicht für Schicht die Bedeutungen abtragen, die sich über den einzelnen Wortkernen abgelagert haben. Zugleich aber bedient sich Schmatz bei dieser Baggerarbeit einer Unzahl von Mitteln aus der Rhetorik und Poetik: Es ist, als würde alles in einem perfekt ausgestatteten Laboratorium der Poesie analysiert. Es lohnt sich aber, und das ist ein Zeichen ernsthafter Poesie, sich auf den Text Wort für Wort, Vers für Vers einzulassen, das aber kann einem, ich gebe es zu, bald zu anstrengend werden. Wenn sich Ermüdung einstellt, hilft in diesem Falle ein probates Mittel: Man lese sich den Text laut vor und man wird sich selbst, und wenn man gut liest, auch allfällige Zuhörer überzeugen. So kommt zur Evidenz, wie das Potential des Lautmaterials den komplexen Satzstrukturen Geschmeidigkeit verleiht. Der Rezensent streicht die Segel, denn hier liegt ein Text vor, zum Sprechen, nicht zum Besprechen.
Erzählen unter dem Aspekt des Fernen und Nahen
Karl-Markus Gauß: Ritter, Tod und Teufel (1994)
Karl Markus Gauß (*1954) hat ein in Österreich selten praktiziertes literarisches Genre riskiert und dabei gewonnen: Der politische Essay erfreut sich nicht unbedingt größter Beliebtheit – auch bei jenen, die sich darauf verstehen könnten. Diese schmale Schrift kommt zudem zur rechten Zeit, womit ich nicht die Weihnachtszeit meine, wiewohl gerade diese Broschüre auf viele Gabentische gelegt werden sollte; sie kommt zur rechten Zeit, da nun das, was nach dem 12. Juni 1994 geschehen ist, uns Österreichern offenkundig mehr Schwierigkeiten bereitet als die schon reichlich schwierige Entscheidung dieses Tages. Unter dem (nur auf den ersten Blick) etwas enigmatischen Titel geht es wieder einmal um die österreichische Identität, aber dankenswerter Weise verläßt der Verfasser die so tief eingefahrenen Spuren, auf denen man sich immer noch auf dieses Ziel zubewegen zu können meint. Er übt sich in den Tugenden des guten Essayisten; so bietet er prägnante Beispielerzählungen, wartet freundlich mit einer kleinen Kindheitserinnerung auf, zitiert jene, die sich gerne zitiert hören, aber sicher nicht immer froh sein werden, wenn sie so zitiert werden, nähert sich dem Thema elegant von verschiedenen Seiten und läßt sich kein Paradox entgehen, um sichtbar zu machen, wie schwer es ist, den hoffnungslos verfahrenen Karren weiterzubewegen. Zunächst sind es die Ritter: Hieronymus von Erlach hat auf österreichischer Seite im Spanischen Erbfolgekrieg wacker gefochten und als ehrenwerter Mann gegolten, und erst 250 Jahre nach seinem Tode wurde offenbar, daß er für die französische Seite gearbeitet und die eigenen Soldaten zu seinem Nutzen verraten habe. Dem wird Alexandre Andryane gegenübergestellt, der, als Carbanaro verhaftet, im Brünner Spielberg elend zugrundeging und doch von seiner Utopie nicht ließ; der dritte dieser Ritter ist der weidlich bekannte Georg von Schönerer, dessen Pläne gerade unheilvoll durch seine Gegner realisiert wurden, da sie ihm zuvorkommen wollten – und damit ergibt sich ein gleitender Übergang zur österreichischen Gegenwart und zu jenem Politiker, den, gäbe es ihn nicht, so Gauß, seine Gegner längst hätten erfinden müssen: Dessen Dictum von der österreichischen Nation als ideologischer Mißgeburt wird immer noch von allen angestaunt und bleibt, wie es scheint, ungesühnt.
Mit 1989 setzte Gauß eine Zäsur, damit sei die Geschichte der Nachkriegszeit – lange genug hat sie gedauert – endgültig zu Ende gegangen, ein Ende, das aber, verstehe ich die Gedankenführung richtig, gemeiniglich nicht als Neubeginn gewertet, sondern gleich mit verschiedenen Todessignaturen versehen werde: Tod der Utopie, Tod der Sprache und der Dichtung, Tod der Moral, und was alles noch an Schlagworten in der Alltagsrede verderblich herumschwirrt. Dieser vielfältige Tod sei notwendig, um schließlich das Eine, eben dieses Europa zu erzeugen – eine durchaus bedenkliche Geburt, da durch sie – und ich gebe Gauß' Argumentation verkürzt wieder – Österreich ganz nahe an das vereinigte Deutschland heranrückte. Von »Österreich auf seinem Weg nach Europa« hörte ich vor fast zwei Jahren den renommierten deutschen Historiker Hans Mommsen in Bonn reden – und diese Formulierung floß ihm ganz leicht von den Lippen.
Behutsam läßt sich Gauß auf die Sprache in Österreich und auf die österreichische Literatur ein. Damit betritt er auch den Teufelskreis einer Debatte, und es gibt wenige unerschrockene Ritter, die sich darin so wie er wider verschiedene Anfechtungen und Verführungen im Denken als gewappnet erweisen. Ihm ist völlig zuzustimmen, wenn er sich dagegen verwahrt, im österreichischen Deutsch eine mindere Variante des von Deutschland aus normierten Deutsch zu erblicken; die unheilvollen Auswirkungen des Fernsehens gerade in diesem Punkt sind weidlich bekannt. Gauß steuert eine hübsche Anekdote bei, die – auch wenn sie erfunden wäre – einen unheimlichen Wahrheitsgehalt hat: Als kürzlich in Wien eine amerikanische Kinderserie synchronisiert wurde, mußten die Kinder aus Berlin eingeflogen werden, weil die österreichische Sprachfärbung, von der die ursprünglich vorgesehenen Wiener Kinder immer noch nicht vollständig gereinigt werden konnten, verhindert hätte, was geschäftlich unabdingbar notwendig war, daß die synchronisierte Serie nämlich nicht nur im österreichischen Fernsehen gesendet, sondern auch an deutsche Stationen verkauft werden konnte.
(Am Rande sei eine persönliche Bemerkung gestattet: Ich verfalle allen Ernstes in depressive Zustände, wenn ich mancher humoriger Kinderserien am späten Nachmittag zufällig ansichtig werde: Wo sind die Kinderfreunde und Freunde Österreichs, die solcherlei unterbinden?) Mit Recht wehrt sich Gauß auch gegen die mundartige Heimeligkeit und Hemdsärmeligkeit, und wenn der ja nicht weiter erregende Umstand, daß Erdäpfelsalat trotz EU weiterhin so heißen darf, vom ehemaligen Bürgermeister Wiens als ein vom Außenminister erstrittenes »Privileg« gefeiert wird, erkennt er mit Recht darin die bedenkliche Zurechtstutzung des Österreichischen auf ein »Kuchelösterreichisch« und eine fragwürdige Demutshaltung, die eine Selbstverständlichkeit als Errungenschaft zu feiern bereit ist. (42f.) (Warum er dann gleich die kuriose und sicher nicht typisch österreichische Verbform »frägt« serviert, ist mir unerklärlich.)
Heikler als das Sprachproblem ist die Frage nach der österreichischen Literatur; daß diese bedenkenlos der deutschen Literatur zugeschlagen wird, ist, so Gauß, »längst nicht mehr Folge böser Vorsätze oder bewußter politischer Entscheidungen«, (50) es ist, so meine ich, zu einer betrüblichen Selbstverständlichkeit geworden. Gerade in der Literatur sind die Übergriffe besonders bedenklich. Gewiß, Hrdlicka gilt derzeit als österreichischer Bildhauer, Gustav Mahler als österreichischer Komponist und Hans Krankl als österreichischer Fußballer. Aber: »Die Frage, ob ein Autor deutscher Sprache Österreicher, Schweizer oder Deutscher ist, kümmert den Leser wenig. Der Dichter Rainer Maria Rilke, geboren in Prag und Hugo von Hofmannsthal geboren in Wien, gehören ebenso zur deutschen Literatur wie die Erzähler Robert Musil aus Klagenfurt, Thomas Mann aus Lübeck und Franz Kafka aus Prag. Was wäre ferner die deutsche Literatur ohne die Schweizer Gottfried Keller oder Max Frisch, ohne die Österreicher Adalbert Stifter oder Thomas Bernhard, ohne den in Rumänien geborenen Lyriker Paul Celan? Die Werke aller dieser Autoren sind Beiträge zur deutschen Literatur.« So zu lesen in einer ambitioniert wirkenden Fremdenverkehrsbroschüre unter dem Titel Tatsachen über Deutschland aus dem Jahre 1990. Die österreichische Literatur wird solchermaßen zu einer Tatsache über Deutschland; so auch in einer jüngst im C. H. Beck-Verlag erschienenen Geschichte der deutschen Literatur nach 1945; diese von namhaften Gelehrten besorgte und mit bestem bibliographischen Wissen und Gewissen erarbeitete Literaturgeschichte will wieder eine »gesamtdeutsche« Literaturgeschichte sein, wobei das Wort »gesamtdeutsch« wohlweislich unter distanzierende Anführungszeichen gesetzt wird. (Allerdings sehr weit reicht dieses »Gesamtdeutsche« nicht ins Österreichische hinein: Canetti kommt en passant vor, Albert Drach überhaupt nicht – immerhin zwei Büchnerpreisträger; Doderer darf zwischen Hans Henny Jahnn und Alfred Döblin Platz nehmen, und Herzmanovsky-Orlando wird keiner Erwähnung für würdig befunden.) Dabei werden die österreichischen Autoren durchaus in kritischen Ehren gehalten, aber entscheidend ist doch, daß sie erst dann wahrgenommen werden, wenn sie im bundesdeutschen Kanon aufscheinen und somit überregionale Geltung erhalten. Für Österreich bleiben daher nach Gauß »steirische Dialektgedichte und Zillertaler Bauernepen« (60) übrig. Ein Vorwurf trifft auch die österreichische Germanistik, die, um die Skylla einer verwaschenen Österreich-Ideologie zu vermeiden, prompt der Charybdis der Österreich-Kritik auslieferte, und – im Gefolge von Magris und Greiner (Tod des Nachsommers) den Schriftstellern hierzulande bei der Würdigung der ästhetischen Leistung schlicht ein politisch falsches Bewußtsein vorrechne. Gauß' Vorschlag, »in der österreichischen Geschichte selbst nach jenen Ansätzen zu suchen, die der Nation demokratische Impulse geben könnten,« ist zu beherzigen, zu beherzigen wäre vielleicht auch eine Lektüre der österreichischen Texte, die sich von der manifesten apolitischen Geste einschüchtern und sie nach ihrer latenten politischen Aussagekraft befragen lassen: So würde sich manches, was schnell als konservativ abqualifiziert wird, als ein Nest des Widerstandes entpuppen. Gauß geht es um diesen Widerstand im Kleinen. Ihn zu bewahren ist nicht »gefährlicher Kult des Unterschieds« oder »Fanatismus der Abweichung«, sondern für viele Nationen und Menschen ein notwendiger Schutz zur Rettung der Individualität. »Der Nationalismus, wie er in unseren Amtsblättern zeitgemäßen Verhaltens gegeißelt wird, ist immer ein Nationalismus des Kleinen«, meint Gauß, »indes der zivilisierte Nationalismus großer Staaten, welche Macht und Mittel haben, ihre Interessen durchzusetzen, als Politik der realen Vernunft gerechtfertigt bleibt.« Dem Autor ist hoch anzurechnen, daß er nicht in der Tonlage der neuen Volkstümlichkeit verfällt und hinterwäldlerisch-mundgerecht Österreichisches positiv durch Abhebung von der deutschen Folie profilieren will. Er vertraut sich nicht den nostalgischen Österreich-Bildern eines imaginären Landes an, und die peinliche Mitteleuropa-Suada, die vielen trotz des beschämenden Umgangs mit Menschen aus eben diesem Mitteleuropa weiterhin aus der Feder rinnt, ist seine Sache nicht. Er meidet das apokalyptische Pathos, aber nicht den Witz. Dieser Essay läßt sich auch als Schelt-rede wider Österreich lesen, aber eine solche hält nur einer, dem es mit Österreich ernst ist, und der weiß, daß larmoyante Querulanz die Erkenntnis von Unterschieden verhindert. Auf diese kommt es an, denn: »Unterschiedenes ist gut.« (Friedrich Hölderlin)
brütt oder Die seufzenden Gärten (1998)
Elfriede Jelinek: Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr (1985)
Die Diskussion um das Werk der Elfriede Jelinek scheint an diesem Werk vorbeigelaufen zu sein – gerade dieser Umstand führt mich dazu, nach den Ursachen zu fragen. Sieht man einmal vom dramatischen Werk der Autorin ab, das in letzter Zeit immer nachhaltiger in den Mittelpunkt des Interesses gestellt wurde, so sind vor allem Die Liebhaberinnen, Die Klavierspielerin, Lust und Die Kinder der Toten, die sich in höherem Ausmaß der Aufmerksamkeit der Kritik und Literaturwissenschaft erfreuen dürfen. Die »Fälle« Jelinek und Bernhard sind nicht unverwandt: Da wie dort gilt der Autorfigur erhöhte Aufmerksamkeit, ja es scheint so, als wollte man beide immer wieder auf die Authentizität des Biographischen festnageln. Jelinek hat gegen die diese Ikonenpflege immer wieder Protest eingelegt, erfolglos, nicht zuletzt deshalb, weil sie diese auch immer wieder förderte, nicht ganz mit eigenem Willen, aber doch auch. Dabei spielen weniger die Versuche, sie zu einer Staatsfeindin zu stilisieren, eine Rolle als vielmehr das Erstaunen darüber, wie sich diese Eleganz mit einer solchen Kraßheit in der Prosa (wir werden noch Beispiele hören) und vor allem mit dem mehr oder weniger, aber unregelmäßig instrumentalisierten politischen Engagement – sie war einige Zeit hindurch Mitglied der KPÖ – vereinbaren läßt. Die Jelinek-Rezeption läuft nicht ganz ohne Grund über diese Schiene. Trotz bemerkenswerter Ansätze (Marlies Janz, Eva Meyer, Juliane Vogel) hat der literaturwissenschaftliche Diskurs dieses Werk (im Vergleich zu Bernhard oder Handke) eher stiefmütterlich behandelt, und wenn, dann sind es meist Themen wie Feminismus oder Politik, derer sich die Interpret/inn/en annehmen. Diese Fragestellungen sind freilich von zentraler Bedeutung, ich möchte aber doch meinen, daß man den Texten der Autorin auch einmal mit Blick auf die meist nur emphatisch bewunderte Sprachgewalt genauer befragen sollte. Das hat einiges für sich, wie ich meine.
Sprachstrategien
Zunächst läßt sich so erstens die Differenzqualität zu den anderen Texten, die hier zur Diskussion stehen, besser erfassen, zweitens glaube ich, daß gerade in den Sprachstrategien das vermittelt wird, was sonst von außen her als Feminismus oder politisches Engagement andiskutiert wird. Drittens wird somit auch ein Zusammenhang sichtbar, der diese Autorin in dem innerliterarischen Diskurs Österreichs besser lokalisierbar macht. Immer hat Elfriede Jelinek auf ihre Anfänge in den Zonen der Grazer manuskripte hingewiesen, auch wenn sie dort – zusammen mit Michael Scharang – 1969 Position gegen die Haltung der Herausgebers Alfred Kolleritsch, Peter Handke und Klaus Hoffer bezogen hat, die sich von einer direkten politischen Wirksamkeit der Literatur distanziert hatten. In einem späteren Interview erklärte Jelinek, sie habe auch damals nicht an die Veränderung durch Literatur geglaubt – das sei ein Akt der Solidarität gewesen. Sie selbst sei in dieser sprachkritischen Übung der Grazer manuskripte aufgewachsen. Gleichgültig, wie man dazu steht, diese pragmatischen, ja geradezu institutionengeschichtlich fixierbaren Zusammenhänge sollten nicht ganz übersehen werden, denn sie lassen sich bis in den hier zur Diskussion stehenden Text verfolgen.
Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr ist gegen Ende 1985 erschienen, also am Vorabend der Waldheim-Affäre, die Österreichs Autoren so zu schaffen machte. Und doch liest er sich heute so, als wäre er nach der Waldheim-Affäre erschienen. Ich will hier Elfriede Jelinek nicht prophetische Gaben unterstellen, sehr wohl aber zeigen, wie sehr so ein Ereignis eben nicht als ein Fall für sich genommen werden kann, sondern allenfalls als ein Exponent. Ich will Waldheim nicht exkulpieren, aber ihm blies der Wind ins Gesicht, der vielen anderen auch ins Gesicht hätte blasen müssen, nur wurden nicht alle Bundespräsidenten.
Es wäre nun verfehlt, diesen Text (wie überhaupt die ganze Literatur dieses Zeitraums) von der Affäre Waldheim her zu lesen. Wäre dem so, dann müßten ja alle Autoren Waldheim unendlich dankbar sein, daß er ihnen endlich eine Aufgabe gegeben hat.
Es geht vielmehr um die Symptome, denen Jelinek in ihrem Text Konturen gibt. Und diese Konturen werden bestimmbar durch die Sprachstrategien, die in diesem Text eingesetzt werden. Doch ehe wir uns diesen zuwenden können, sei ein Blick kurz auf die Gesamtkomposition geworfen. Der Text führt die nichtssagende Gattungsbezeichnung »Prosa«. Damit distanziert er sich von jeder Zuordnung zu einem im engeren Sinne erzählenden Genre; dieses Buch ist auch, so möchte ich betonen, extrem antinarrativ gehalten. In ihrem Verhältnis zur Narrativität wären diese Texte zu untersuchen: Bei Haslinger sind wir mit dem Versuch konfrontiert, durch die Wahl von mehreren Perspektiven gleichsam eine differenzierende Blickführung zu ermöglichen. Wir kennen die Wahl der Berichterstatterfigur, in Alte Meister in mehrfacher Brechung, in seltsamer Schwundstufe auch in Auslöschung anwesend. Schließlich haben wir Ransmayrs Versuch, einen unbefragten Erzähler zu installieren, der mit der Souveränität des griechischen Epikers ausgestattet zu sein scheint und zuletzt bei Menasse das verschiedentliche Spiel mit einer Kamera beobachtet, die das Geschehen aufzeichnet, aber dann doch irgendwie versagt: Der Chronist, der vom hohen Roß herunterfällt. Es ist höchst bezeichnend für diese ganze Debatte, daß Handke in seinem Königsdrama Zurüstungen für die Unsterblichkeit eine Figur eingeführt hat, die er »Erzählerin« nennt.
Bei Jelinek schließlich fällt die Frage nach der Erzählperspektive so gut wie ganz weg. Wer ist es, der hier erzählt? Wer spricht? Und wen kümmert es, wer spricht? Ich halte diese Frage jedoch für höchst aufschlußreich, weil dadurch gerade der so komplexe Text seine Eigenart gewinnt. Es ist so, als ob einer dauernd bespräche. Innen- und Außenperspektive changieren in einem fort. Der Text wird – etymologisch sinnfällig – als ein Gewebe von Stimmen verstanden. Und diese Stimmen gehen einerseits ganz nahe an die Figuren heran, sie sind sie, sie distanzieren sich andererseits auch völlig von ihnen. Es ist eine extreme Kunstsprache, die durchgehend auf sich selbst zeigt: Seht her, so werden die Sätze gemacht, so hängen die Worte zusammen. Um das Verhältnis zum Erzählen zu charakterisieren, ist der Blick auf den Gebrauch der Tempora förderlich; ich halte mich hier an die ganz praktikablen Anweisungen, die Harald Weinrich in seinem Tempus-Buch gegeben hat: Vor allem die Unterscheidung besprochene und erzählte Welt, wobei im Deutschen jener die Tempusgruppe I mit Präsens, Perfekt und Futurum, dieser Imperfekt und Plusquamperfekt. Der Verdacht, daß die Österreicher nicht erzählen könnten, weil ihnen infolge des süddeutschen Präteritalschwundes (seit dem 15. Jahrhundert) die für das Erzählen nötigen Tempora abgingen, ist so abwegig nicht. Das Imperfektum macht ja jeden erzählten Text für den Österreicher irgendwie fremd. Aber die Entwicklung, auf das Präteritum zu verzichten, hält ja vor. Der Text der Elfriede Jelinek ist durchgehend im Präsens abgefaßt, aber eben nicht in einem historischen Präsens, das den Eindruck simuliert, als ob hier etwas so erzählt würde, als würde es besprochen. Hier spricht eine unbekannte Instanz, die sich manchmal mit den Personen identifiziert, die manchmal über ihnen steht, die sich ganz grundsätzlich von ihnen distanziert. Dadurch entsteht nie so etwas wie eine Handlung, die sich gleichsam protokollarisch – wie eine Zeugenaussage – aufzeichnen ließe: Immer entzieht sich der Text dieser Umsetzung in den Bericht. Wollte man eine erzählerische Achse durch den Text legen, so scheitert man kläglich, wenngleich eine solche immer wieder sich zu bilden scheint. Tatsächlich aber ist diese Achse durchgehend durch Frakturen stets zerstört. Zwar läßt sich ein chronologisches Nacheinander erkennen, ja wenn man will, kann man (und man muß es als Rezensent sogar tun) eine Inhaltsangabe von dem Ganzen anfertigen. Ich folge der Einfachheit hier dem Referat Ulrich Weinzierls: Im Zentrum des Mitleids steht die siebzigjährige Dichterin Aichholzer, die hoch droben am Berg und von ihren Erinnerungen an einen bedeutenden Philosophen lebt. Dieser hat sich anno Hitler nicht nur im nationalsozialistischen Herrendenken, sondern später auch, als betagter Weiser, in sexuellen Aufschwüngen bewährt. Die Dichterin, die sich gerne mit heranreifenden Intellektuellen umgibt, lebt übrigens von ihren Erinnerungen in des Wortes genauestem Verständnis – sie schreibt ihre Memoiren. Das Hauptinteresse der Aichholzerin – so nennt man sie im Freundeskreis – gilt jedoch dem jungen Holzknecht Erich. Bisher hat er ihr nur, gegen bescheidenes Entgelt, Lebensmittel und Getränke nach Hause gebracht, jetzt möchte sie ihn selbst als Draufgabe. Eine Satire auf den Kulturbetrieb also, mit ein paar verfremdeten, gleichwohl unverkennbaren Details österreichischer Wirklichkeit. Freilich begnügt sich die Jelinek nicht mit Streifzügen durchs kulturelle Unterholz, ihr Thema ist umfassender: der subtile Terror des Medienzeitalters, da das Falsche zum Wahren wird, die zynische Ausbeutung und Selbstausbeutung im Zeichen des Konsumismus, opportunistische »Vernunftehen« im politischen Alltag und die neue Naturmystik der Baumschützer um jeden Preis, sogar um den der Vernunft: »Millionen unterschreiben unterdessen Volksbegehren für die schöne Natur, die den Millionären gehört.« Politiker, die »ihre alte fesche Niedertracht« anziehen, predigende Dichter:
»Geht über die Dörfer hinweg, denn sie gehören euch längst!« und die fatale alpenländische Mentalität »Fremde raus, Touristen rein« – niemand und nichts bleibt hier ungeschoren. Im Grund müßten sich die Objekte – ob Ding, ob Mensch, Freund oder Feind – vor dem entlarvenden Blick der Jelinek fürchten. Nützen würde ihnen diese Angst allerdings wenig: Lauernd und kalauernd stellt sie ihre sprachlichen Fallen auf, in denen sich fängt, was ihre Aufmerksamkeit, ihr Mißfallen erregt.
Im Schlußkapitel ist es die Jagdgesellschaft eines Kaufhauskönigs. Ein Jagdgast, die Managerin eines deutschen Industriekonzerns, hat es gleichfalls auf den hübschen Holzfäller Erich abgesehen. Kurz bevor die »Landesträchtigkeit« am Ziel der erotischen Wünsche ist, ergreift Erich die Flucht. Im streng bewachten Jagdrevier wird er von einem Leibwächter des königlichen Kaufherren erschossen. »Schon wieder ist ein Vertreter der Mehrheit umgefallen«, kommentiert Jelinek mit der für sie typischen Trockenheit, »und keiner merkt es, denn an den Menschheitsverhältnissen ändert das überhaupt nichts«. Man könnte solche Lakonik mit Zynismus verwechseln, aber es ist nur der traurige Spott auf eine Welt, die alle Trauer verhöhnt.«
Freilich ließe sich das noch um einige Angaben erweitern, so etwa die unglücklichen Lebensumstände Erichs betreffend, dessen Frau ihn verlassen hat und mit den beiden Kindern zu einem Mann nach Tirol gezogen ist, so über dessen Schwester, die an Krebs stirbt und deren Mann sie verlassen hat und mit einer Trafikantin aus Villach lebt, den Tod der Frau erwartend, nur um ein neues Leben beginnen zu können. Auch daß die Aichholzerin sich am Ende des zweiten Teiles zu Tode stürzt, wäre noch besonders zu erwähnen; aber auch, daß eben ihre Geschichte nicht zu Ende erzählt wird. Doch dieses Handlungsgerippe läßt keine Rückschlüsse auf die Substanz und Organisation dieses Textes zu. Es fällt aber auf, daß man versucht ist, diese verschleierte, aber doch vorhandene Handlung zu rekonstruieren: »Keine Geschichte zum Erzählen« heißt auch die zweite Partie des Textes, die deutlich eine Absage an die Erzählbarkeit von Welt erhält. Aus dieser Spannung, Inhalte doch nicht anders als erzählend mitteilen zu können, und aus der Unmöglichkeit des Erzählens an sich ergibt sich die eigentümliche Dynamik dieses Textes, der einerseits sehr wohl von Ereignissen handelt, der aber andererseits keinen Bericht, keine Erzählung zuläßt, sondern aus allem eine Sprachfigur werden läßt.
In Form eines Exkurses ist es angebracht, hier auf diese Polemik wider das Erzählen zu verweisen, die ab Mitte der sechziger Jahre ja geradezu zur Signatur der jüngeren österreichischen Literatur wurde. Handke hatte ja mit seinem Hausierer nur mehr die Struktur eines Kriminalromans vorgelegt, Bernhard sprach von sich als dem typischen »Geschichten-zerstörer« und Scharang gab einem Band mit kürzeren Texten den Titel Schluß mit dem Erzählen und andere Erzählungen – eine Entwicklung die sich ja schon zwischen den beiden Weltkriegen bei Rilke, Musil, Broch und mit Abstrichen auch bei Döblin abgezeichnet hatte, die aber – denn wir brauchen Erzählungen – auf die Dauer über das Experiment hinaus wenig Fortune machte. In seinem Roman Die Wiederholung preist Handke die Erzählung schlechthin; Scharang, Menasse, ja auch Haslinger waren mit ihren Texten bald (nicht selten unter der Schutzgottheit Lukács) wieder als Erzähler am Werke. Das heißt nun freilich nicht, daß das Vertrauen in das Erzählen ungebrochen ist; aber es ist klar, daß das Erzählen unhintergehbar ist. Zum anderen aber ist ebenso klar, daß das Erzählen in jedem Fall Ungenauigkeit mit sich bringt. »So wie es gewesen ist, kann man es nicht mehr erzählen«, heißt es bei Christa Wolf; der Schein, der durch das Erzählen hergestellt wird, soll abgebaut werden. An der Destruktion dieses Scheines arbeitet auch die Erzählerin Jelinek, eine Scheinhaftigkeit, die durch die Sprache hergestellt wird, die gleichsam sprachimmanent ist.
Des öfteren hat Jelinek auf ihre Tradition hingewiesen, wobei sie vor allem die jüdische Tradition gemeint hat, und namentlich den Satiriker Karl Kraus. Karl Kraus hinwiederum hat für seine Sprachkritik wesentliche Impulse von Nestroy empfangen, und Elfriede Jelinek hat auch diesem ihre Reverenz mit dem Stück Häuptling Abendwind erwiesen. Die Sprachkritik Elfriede Jelineks kann in dieser Tradition ohne großen Zwang geortet werden, wenngleich die Unterschiede doch auch wesentlich sind; doch gerade auf Grund dieser Unterschiede sollten die Gemeinsamkeiten ihr Relief gewinnen. Ich gehe auf einige Beispiel aus Nestroy kurz ein. Wenn etwa der Titus Feuerfuchs im Talisman auf die Frage, was denn sein Vater mache, antwortet, er sei »Verweser seiner selbst« und dann kurz zusammenfaßt: »Er ist tot«, so wird damit ein Prozeß bewußt gemacht, der auch für die Konstitution der Jelinekschen Sprache wesentlich ist: Durch die Sprache wird, wie dies Siegfried Brill in seiner Dissertation Komödie der Sprache zu Nestroy herausgearbeitet hat, ein Schein erzeugt. Dieser Schein wird, zum Teil durch die Sprache selbst, zum Teil durch die Aktionen auf der Bühne entlarvt. Die Sprache etabliert den Schein durch ihre Bilder, durch die Metaphern, durch die Redensarten.
Wenn in dem Zerrissenen Nestroys der Bauer Krautkopf zu den Bauern, die Kraut und Rüben durcheinanderwerfen, sagt: »-Kraut und Ruben werfeten s'untereinand wie Kraut und Ruben,« so steckt in diesem auf den ersten Blick so platten Scherz ein Stück Sprachgeschichte und ein Stück Sprachphilosophie: Der Bauer weiß gar nicht, mehr, auf welche materielle Substanz die von ihm verwendete Redewendung »wie Kraut und Rüben« hat; sie hat sich verselbständigt. Die Wirklichkeit auf der Bühne überführt diese Rede der Scheinhaftigkeit. Nestroys Texte erhalten ihre Dynamik eben aus diesem Einsatz sprachlicher Mittel, durch die ein Schein erzeugt wird. Zwar zerstört Nestroy auch durchgehend die durch das Bildgedächtnis verbürgte allegorische Tradition; er läßt sie in keiner Weise unbefragt gelten, aber die Bilder sind in sich geschlossen und stimmig, wenngleich beschädigt. Jelinek hingegen arbeitet mit dem bewußt eingesetzten Bildmißbrauch, der Katachrese, oder auch des Oxymorons. Etwa: »Dieses läufige Land vernichtet mich, es ist hinter mir her.« Daß etwas landläufig sein kann, ist bekannt, daß aber ein Land läufig ist, wohl weniger; auch kann ein Land nicht hinter einem her sein, aber wenn es dann doch läufig ist, paßt wieder alles ins Bild. Auch die Allegorien werden gerne verwendet, doch meist so, daß sie ganz plötzlich hergestellt werden: »Doch im ungeeignetsten Moment klopft die Natur wieder an die Tür, sie hat frische Eier zu verkaufen.«(42) Genitivmetaphern leben davon, daß der Bildspender semantisch möglichst weit vom Bildempfänger angesiedelt ist; die zentrale Thematik, die Naturthematik (davon später) begegnet etwa in einer Fügung wie »Falschgeld der Natur« (45); so als ob die Natur nicht das schlechthin Echte wäre. Aber gerade diesen Schein zu unterlaufen, ist der Text organisiert. Besonders kennzeichnend ist die kurzschlußartige Verbindung, die einerseits in der Natur der Metaphern selbst liegt, die aber durch Zeugmata hergestellt werden können: »Ein Bauer geriet vor dreißig Jahren ins Schneebrett und meidet heute noch Naturprodukte.« (47) Oder folgende zeugmatische Verbindung: »Der Tüchtige steigt bergan, der Ungelenke einem anderen aufs Fußgelenk.« (8)
Als der reichste Steinbruch für den Sprachabbau der Jelinek erweisen sich die Redewendungen. Kühne Substitutionen demontieren den Schein, den diese Redewendungen erzeugen: »Diese neuesten frisch gewachsten Regierungsmuskeln auf dem Minderheitsbankerl (die jede Minderheit sofort bekämpfen, wo sie noch eine finden), die lassen keinen Halm zu hoch in den Heimathimmel wachsen.« (166) Es geht hier um die sogenannte »kleine Koalition«, die von 1983 bis 1986 in der Zeit nach Kreisky bestand und die Sozialdemokraten mit den (damals liberaleren) Freiheitlichen verband. Die »gewachsten« Muskeln sind natürlich eine Katachrese; gewachst kann allenfalls die Bank sein, aber sie sind ja auch gewachsen. Nicht die Bäume wachsen in den »Heimathimmel«, sondern die »Halme« – die kleinere Regierungspartei fürchtet, daß andere Kleine, etwa die Grünen, in den Heimathimmel wachsen könnten. Es wäre durchaus sinnvoll, die rhetorische Praxis, mit der Jelinek die einzelnen Klischees demontiert, minutiös zu beschreiben. Denn so wie die Rhetorik den Schein etabliert, so vermag sie diesen auch zu demontieren. Regelverstöße sind dabei das verläßlichste Mittel; Zeugma und Katachrese sind, meist von Parallelismen gestützt, die wichtigsten Komponenten dieses Verfahrens. Dieses Verfahren läßt sich durchaus mit dem vergleichen, das Karl Kraus als das Programm der Fackel vor ziemlich genau hundert Jahren herausbrachte, indem er von der »Austrocknung des Phrasensumpfes« sprach, allerdings geht die Sprachdogmatik von Kraus doch ganz andere Wege, das gewählte Verfahren indes ist durchaus analog.
Das Wortspiel, manchmal bis zum Kalauer reichend und dessen Qualitäten nicht verschmähend, ist sicher auch eines der wichtigsten Verfahren Jelineks: »In der Natur regiert die Natter, reagieren die Menschen oft falsch.« (46) Natur-Natter, regiert-reagieren – die recht platte Parallele Natur-Natter wird gestützt durch regiert-reagieren, wodurch beide Gedanken doch recht subtil miteinander parallelisiert werden. Ähnlich wie Nestroy tastet Jelinek Wortfelder ab, stellt auf lautlicher oder semantischer Ebene überraschende Verbindungen her. Oder: »Daher: Entwerfen wir den Ring des Nie Gelungenen!« (106)
Doch darf Jelineks Prosa nicht nach dem Rhetorik-Handbuch aufgelistet werden, wenngleich sich manchmal darin auch die schönsten Beispiele finden. Für uns ist wichtig, daß die Praxis gerade jenen Figuren nahekommt, die bewußt semantische Normen (Katachrese) oder syntaktische (Zeugma) angreifen. Das läßt, was die Sprachbehandlung betrifft, doch auch weitere Schlüsse zu: Hier verläßt die Sprache die Kontrolle der auf die Richtigkeit bedachten Denkorgane; die bewußte Normverletzung ist Gegenstand dieser abundanten Rede. Eine Formulierung von Patricia Parker über die Unterschiede von Metapher und Katachrese und deren historische Auseinanderentwicklung wirft ein Schlaglicht auf diese Prosa der Jelinek: Das gewaltsame Eindringen der Katachrese und die Möglichkeit von Übertragungen, die ungewollt das Modell des kontrollierenden Subjekts subvertieren, sind die gotische Unterseite der Beherrschung der Metapher, das unheimliche andere seines Willens zur Kontrolle. Wesentlich wird durch diese Handhabung der Metapher in der Ausprägung als Sonderart der Katachrese eben der Eindruck vermittelt, daß hier nicht eine Sprecherin eine Sprache spricht, sondern die Sprache die Sprecherin. Der Redefluß reißt einfach immer das mit, was dem einzelnen Wort benachbart ist, er spült den Uferrand weg. Man könnte sagen, daß nicht das Wort selbst, sondern das Wort daneben zum wichtigen wird. Zu erwähnen auch, daß diese Praxis nicht nur für diesen Prosatext Jelineks gilt, sondern schon in den Liebhaberinnen entwickelt und in der Folge immer mehr intensiviert wurde. Ich meine, daß das, was als satirische Substanz dieser Prosa zu gelten hat, am ehesten über diese Sprachstrategien ermittelt werden kann. Denn würde es nur darum gehen, die verderblichen Verhältnisse aufzudecken, so wäre dies ja in Form des Traktats oder Pamphlets oder der Dokumentation sicher eindeutiger zu bewerkstelligen. Die Sprache der Jelinek aber zerstört jene Evidenzen, auf die sich jene berufen können, die meinen, sie wären durch die Sprache hinlänglich abgesichert, um den Schein, den sie zu ihrer Verteidigung benötigen, auch aufrecht erhalten zu können. Erst durch die Sprachkritik wird eben die Verlogenheit, mit der jene den Naturdiskurs okkupieren, faßbar. Man könnte auch anders herum argumentieren: Diese Literatur muß etwas leisten, was die Dokumentation, der kritische Essay, die Recherche nicht kann, wenngleich sie sich auf diese beruft. Dadurch, daß der Schein bewußt hergestellt und wieder zerstört wird, ist die suggestive Kraft dieser Prosa größer, als die des Traktats, die nur auf das an sich Falsche verweist. Durch die Verklammerung der einzelnen Sätze untereinander mit verschiedenen rhetorischen Figuren, Assoziationen, Anklängen entsteht ein Zusammenhang, der die durch das Erzählen geforderte Ordnung überwuchert. Es entsteht somit auch eine eigene Sprachhandlung, die, wenn man so will, den récit so zum Verschwinden bringt, daß er zuletzt völlig nebensächlich zu werden scheint.
Natur-Diskurs
Scheint. Denn gerade durch diese rhetorische Panzerung wird das Thema auf seine Weise nur triftiger. Jelinek hat mit diesem Buch in dem so intensiv geführten Natur-Diskurs – und dieser Diskurs ist vital wie damals – eine Position bezogen, die trotz aller Parteilichkeit sich von der unreflektierten Form jeder Parteinahme freizuhalten versteht. Ich insistiere darauf, daß in der Literatur so etwas eben nicht durch Emphase oder Pathos herbeigeführt werden kann, sondern nur durch eine reflektierte Sprachstrategie, und nur dadurch kann so ein Text auch seine Eigenqualität bewahren gegenüber Recherche und Dokumentation. Um 1965 gab es bekanntlich in Österreich die vehementesten Auseinandersetzungen bezüglich der Errichtung eines Wasserkraftwerkes bei Hainburg östlich von Wien an der Donau; eine Aulandschaft hätte zerstört werden sollen, um den Wienern die Stromversorgung zu sichern. Die Protestierenden setzten sich durch. Die Naturfreunde konnten das Ganze zur Happeningtradition ummünzen; man sprach von Bruder Hirsch und Freund Baum, verkleidete sich und war plötzlich Teil dieser Natur – ein komisches Schauspiel. Die auflagengrößte Zeitung Österreichs, die Kronen-Zeitung, stellte sich auf die Seite des Protestes und usurpierte damit den Ruf, so etwas wie Avantgarde des Naturschutzes zu sein; daß einem der Herren dieser Zeitung auch das Augebiet als Jagdgebiet zum Teil gehörte, wurde kaum Gegenstand der Debatte. Man sieht, wie genau Jelinek auch, wenngleich en passant, solche Details anspricht. Daß diese Intensivierung des Gesprächs über die Natur mehr war als ein bloße Mode-Erscheinung und auch nicht nur aus einem sentimentalen Bedürfnis heraus zu erklären ist, sondern mit Reflexion unterschiedlicher Intensität und Qualität bedacht im Zentrum der Literatur stand, ist schon im Zusammenhang mit Bernhard erörtert worden. Daß gerade die Natur in Österreich so sehr in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung rückte, darf nicht weiter verwundern, da ja es die Natur ist, mit deren Hilfe das Besondere des Österreichischen wesentlich definiert werden sollte, ein Staatsdoktrin gleichermaßen, die die gute Natur gegen eine immer problematischer werdende Zivilisation hält und Natürlichkeit auch als Garanten für die Qualität der Kunst in Ehren gehalten sehen möchte.
Gerade gegen diese doch immer wieder nachhaltig vertretene Auffassung, daß die Kunst natürlich zu sein haben, hat Jelinek im Verein nicht nur mit Bernhard sondern auch mit der Avantgarde Protest eingelegt. Die Dichterin Aichholzer ist so eine, deren Credo die Identität des gelungenen Naturprodukts mit dem Kunstprodukt ist: »Die Natur trägt einen gemeinsamen Anzug mit der Kunst, und so kann immer nur einer von den beiden vor Publikum auftreten.« (95) Und weiter: Die Natur läßt sich nicht planen, das Naturgedicht schon. Sie schaut alles an, diese riesigen Buchten voll Überraschungen, die beißen und bluten und schreien. Bald wird sie tot sein und sich auflösen. Aber heute noch ist es ihr möglich, Vorbild Natur und Ergebnis Gedicht miteinander zu vergleichen. Das Vorbild verändert sich ständig, daher ist das Ergebnis ungleich besser. [...] Sie ist der Schiedsrichter, der die Grashalme austauscht, die Tanne vom Feld nimmt und nachspielen läßt. Dann legt sie ihre Gedichte auf den Tisch, was sie wiegen, das haben sie. Aus.« (95f. vgl. auch 121) Zu Beginn des letzten Kapitels wird noch lapidar angemerkt: Was anderen Unberatenen die Kunst ist, äußerste Provokation durch etwas ganz und gar Unvollkommenes, das sich dennoch nicht ohne weiteres nachahmen läßt, ist ihr [Frau, die Managerin] die Natur ringsumher. [...] Über die Natur wäre noch anzumerken, wollte man sie auf dem Papier beschreiben für solche, die sie noch nie richtig gesehen haben: Sagt die Kunst so, sagt die Natur etwas ganz anderes. (199)
Die Festsetzung der Relation Natur/Kunst erfährt ebenso ihre satirische Konterkarierung: »Die hier hausen sehen überall im Umkreis nur Regale mit Waren. Sie vergleichen Natur mit Kunst, nicht aber umgekehrt. Sie vergleichen ausschließlich Natur mit Kunst, nicht aber umgekehrt.« (76)
Gerade diese Ableitung der Kunst aus der Natur wird – und dies viel radikaler als bei Bernhard – von Jelinek satirisch demontiert. Diese Destruktion von unterstellter Natürlichkeit bestimmt das ästhetische Programm: Da ist die Rede von einem »Vertreter des kompletten Bausatzes für Anfänger: „Recht und Unrecht für das gelehrige Kind zum Selber Zusammenbauen"« (167), der über das Sonnwendfeuer springt, selbstverständlich rein privat. Mit einem Mädel vielleicht, das gebären muß, wenn es kann. Es geht allein mit und nicht gegen die Natur, es gilt: verwalten, nicht vergewaltigen! Wie für das Weibliche schlechthin, diese größte aller Unordnungen. Die Besitzer der Sau Wirtschaft haben ja immer genügend Zeit und Anlaß zum Sportieren gehabt. Und fürs Aussortieren von Aas ebenfalls. Und damit schließt sich der Kreis schlußendlich wieder fürs reine Erzählen, und wir begeben uns ein letztes Mal in die Natur hinein, solange der Vorrat reicht. (167) Ich halte diese Stelle für das ästhetische Programm der Jelinek von großer Bedeutung: Einerseits wird hier die Volksverbundenheit der besitzenden Klasse und intellektuellen Kaste aufs Korn genommen: Diese huldigt dem Brauchtum und der Überzeugung, daß die Frau fürs Gebären da sei, so wie sie für das Verwalten und nicht für das Vergewaltigen. Das Weibliche, »diese größte aller Unordnungen«, muß daher verwaltet werden. Und der Sport («Sportieren«) ist das Zeichen der Herrschenden Klasse, das auch für diese Verwaltung eingesetzt wird: Sie besitzen die »Sau Wirtschaft« – die beiden Worte werden eben getrennt geschrieben – ein Prozeß spontaner Allegorisierung: Die Wirtschaft ist eine Sau, und mit der Sau und mit dem auszusortierenden Aas sind wir schon wieder bei der Landwirtschaft und damit in der Natur, und die Natur ermöglicht das »reine Erzählen« – daher begibt man sich in die Natur. Gerade dieses »reine Erzählen« versagt und untersagt sich die Autorin in diesem Text, und gerade das ist ein Punkt, den Handke in seinen theoretischen Arbeiten damals immer wieder angepeilt hat: die pure Erzählung. Es geht aber über diese bloße Naturproblematik hinaus. Der Text Jelineks (und nicht nur dieser) ist vom Protest der Gleichsetzung des Weiblichen mit dem Natürlichen getragen, vor allem mit dem geschichtslosen Natürlichen. »die alte müstifikation: natur statt geschichte« hat Elfriede Jelinek einmal formuliert, um gegen die platte Enthistorisierung durch den Gang in die Natur zu opponieren. Zu opponieren auch dagegen, daß der Gang in die Natur ablenkt von der Tatsache, daß die Natur ja nicht mehr Natur an und für sich ist, sondern sehr wohl den sich verändernden historischen Verhältnissen unterworfen ist. Der Philosoph, der der Geliebte der Dichterin war, war so einer, der sein Denken aus der Natur ableitete: Draußen Natur, jawohl, glänzend gelungen, sie wird Heimat genannt, falls jemand zufällig drin wohnt. Die hat auch den Philosophen einst belehrt, diese große Lehrerin. Der Philosoph hat sie damals richtig verstanden und kleine harte Käselaibe daraus geformt: Über Natur und Kultur. (129) Der dialektische Zugriff auf die Natur ist das, was Elfriede Jelineks Texte in dieser Debatte so wohltuend und deutlich unterscheidet. Es ist nicht mehr eine Kunstnatur, es geht nicht darum, das Artifizielle gegen das Natürlich zu setzen, wie das in der Neovantgarde gang und gäbe war, sondern es geht darum zu begreifen, wem der so instrumentalisierte Naturbegriff dienen kann: »An den Fettöpfen der Natur muhen die Jagdherren […]« (43) Oder: »Wer kann die Natur schon so lieb anschauen wie jemand, der sonst nichts zu tun hat oder jemand, dem sie gehört?« (157)
Es wäre verfehlt, nun in diesem Text ein einfaches Verdikt wider die Natur zu erblicken; diese erhält zwar – wie bei Bernhard – das Attribut »infam« (49), aber ihr Status ist alles andere denn so, wie er sein sollte. Auch die Schwangerschaftsunterbrechung wird thematisiert; da werden ihre Gegner zitiert:
Ja, schon der Samen lebt bereits, kein Kunststück, denn es lebt die Wüste sogar! Nur die Natur ist hin. Die Lebensschützer schlagen schwitzend auf die steinernen Politiker ein, um ihnen eine Träne für die Hilflosesten zu entlocken, die nicht einmal außerhalb des Gebärmuttersacks existieren könnten. Aber da stehen die Waldschützer bereit: noch hilfloser als der Embryo ist der Baum, der in dieser Gegend schon oft Menschen im Fallen erschlagen hat. Das ist die Rache der Natur an den Unmündigen. (224)
In seinem »dramatischen Gedicht« Über die Dörfer (1981) hatte Handke die Natur als das »einzige stichhaltige Versprechen« bezeichnet. Dies in der Rede der Nova, die parodistisch verzerrt bei Jelinek erscheint: Jäger, haltet zusammen. Denkt richtig! Seid zuhaus! Geht über die Dörfer hinweg, denn sie gehören euch längst! Seid alle gemeinsam! Und als nächstes den Papst anbeten, wenn er sich entschließt, einmal herzukommen. (159) Handkes – in diesem Falle an Heidegger sehr deutlich angelehnte – Sprache wird von Jelinek aufs Korn genommen: Wenn der von Adorno so präzise herausgearbeitet »Jargon der Eigentlichkeit« in solchen Formeln wie »Seid alle gemeinsam!« seine Auferstehung in Gestalt der Satire feiert, so ist dieser Text auch eine Replik auf Handkes Bühnenweihefestspiel. Daß Handkes Opposition gegen die bei Bernhard und Jelinek mehr oder minder deutlich erkennbare kritische Haltung gegenüber der Natur durchaus auf diese Gegnerschaft hin kalkuliert ist, geht aus der geradezu endlosen und gleichsam über die Köpfe der Leser hinweg geführten Diskussion sehr deutlich hervor.
Zugleich hat – und dies sei als ein kleiner philologischer Exkurs von anderer Seite eingebracht – Jelinek Handke auch ihre Reverenz erwiesen. In dessen Kaspar (1968) kommt bekanntlich die sprachlose Bühnenfigur mit einem Satz auf die Bühne: »Ich möchte sein wie ein anderer einmal gewesen ist«. Damit spielt die Autorin immer wieder, vor allem wird damit auch die Identität des Holzfällers Erich umspielt: »Er ist gleich wie ein anderer, nur ist er von hierorts.« (9) Die weiteren Variationen lassen das Muster dieses Satzes – wenngleich teilweise übermalt – doch erkennen: »Sie redet von etwas, wovon ein anderer nie zuvor gehört hat.« (33) »Alles darf so bleiben wie schon einmal etwas genauso gewesen ist.« (58) »Als Dichterin ähnelt sie keinem, der je bekannt geworden ist [...].« (95) Der Satz Kaspars zielt auf den latenten Wunsch, unsere Identität nach dem Bilde anderer zu formen: Jelinek spielt damit, positiv wie negativ, und zitiert damit dieses Stück herbei, in dem es ja darum geht, wie die Identität eines Menschen durch die Sprache aufgebaut wird. Letztlich wird damit auch die Identität der Aichholzerin selbst angepeilt: »Berühmt werden wie der Philosoph einer gewesen ist.« (153) Auch Bernhard muß herhalten; zweimal wird auf seinen Roman Holzfällen und das Verbot angespielt (122, 148), noch markanter aber ist der Verweis auf den Begriff des »so genannte[n] Geistesmenschen« (100; vgl. auch zu Pneumothorax, 99), der ebenfalls aus Bernhards Alte Meister übernommen worden zu scheint, allerdings hier in eindeutig ironischem Kontext. Die Ambivalenz der Natur schlägt sich im Titel nieder, dessen ironisiertes Pathos indes nicht dazu verleiten darf, das Problem Natur als irrelevant abzutun. Im Gegenteil: Bei der Auseinandersetzung um die Natur geht es um Interessen, um sehr konkrete Interessen, die jedoch durch die raffinierte Herstellung von Schein so verhüllt sind, daß sie erst durch die Sprache der Literatur analytisch bloßgelegt werden müssen: »Die Natur ist Reklame. Die Kunst ist auch Reklame.« (127) Die Natur muß daher dort landen, wo die Postmoderne ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat – im Museum: »Naturpark! Naturpark! Museen, wo die Natur sich abspeichert, das Künstliche im insgesamt doch wildlings Gewachsenen.« (265) Dieser Roman der Elfriede Jelinek kommt noch ohne die große Katastrophe aus. Die Kinder der Toten endet bekanntlich mit einer riesigen Mure, die ein Hotel unter sich begräbt und mit ihr jene Gesellschaft, die für Österreich repräsentativ ist. Wir, als die Überlebenden sind daher Kinder der Toten, verurteilt, als Wiedergänger ohne Ruhe weiter zu wandeln. Ist es in der Tat so, daß Veränderung unmöglich geworden ist, daß die Verhältnisse so bleiben, wie sie sind? Das die Zeichen der Macht immer noch bei denen sind, die als Jäger das Sagen haben und die Waffen führen?
9.2. Marlene Streeruwitz
Es gibt wenige Fälle von vergleichbar rätselhafter und zugleich herausfordernder Titelpoesie: Brahmsplatz., New York. New York., Waikiki-Beach., Sloane Square., Ocean Drive., Elysian Park., Tolmezzo. Eine symphonische Dichtung., Bagnacavallo., Dentro., Boccaleone.– In den seltensten Fällen gibt der Titel auch wirklich den Ort an, an dem die Handlung spielt. Sloane Square. und Brahmsplatz. dürfen noch für sich beanspruchen, mit dem Ort etwas zu tun zu haben. New York. New York. spielt auf einer Toilettanlage und wurde auch auf einer solchen aufgeführt. Rätselhaft hat sich die Autorin auch über die Titel und ihre Funktion geäußert: Inhaltsangaben sind unmöglich. Die Verabredung auf einen Titel, der den Inhalt auf eine Chiffre festlegt, geht von einer linearen Faßbarkeit und einer linearen Dynamik aus. Meine Stücke nehmen einen komplizierteren geometrischen Verlauf und entziehen sich dieser –eindeutigen – Chiffrierung. Die Ortsnamen stehen daher für die Welt als Möglichkeit. Was immer das heiße mag: Die Orte sind in den meisten Fällen Traumorte des Österreichers, Orte, an die er sich wünscht. Wie in den anderen hier behandelten Texten stellt sich das kleine Österreich so in die Auslage – es paßt sehr gut zu der Beobachtung, die wir über jenes Anvisieren Österreichs aus der Ferne bei den anderen Autoren gemacht haben. Es ironisiert ganz bewußt die Weltläufigkeit, mit der man sich schmückt und die Sucht, sich durch das Ferne und Exotische, durch das Elegante und Exquisite das Prestige zu erhöhen. So ist die Auswahl grundsätzlich alles andere denn beliebig; zugleich wird auch mit der Enttäuschung der Erwartung ein höchst subtiles und raffiniertes Spiel getrieben. Daß Marlene Streeruwitz (*1950) immer wieder die Ferne einbezieht und als archideischen Punkt wählt, um von dort die Heimat auszuheben, geht aus ihren beiden letzten Romane Lisas Liebe (1998) und Nachwelt (1999) und aus der Erzählung Majakowskiring (2000) hervor. In allen diesen Fällen werden die USA atmosphärisch mit einer Genauigkeit beschworen, die den Verdacht nahelegt, es würde sich da um die zugleich bewunderte und dann doch abgelehnte Gegenwelt handeln. Zugleich geht es in diesen Stücken um Öffentlichkeit: Privatheit sei eine »post-feudale Erfindung« (Streeruwitz 1997, 75) – dies erklärt eben in der Folge auch, warum mit einem Schlage nun auch Könige wieder auf der Bühne als Könige auftreten dürfen, so bei Streeruwitz, und warum etwa Handke auch ein »Königsdrama« schreibt. Das hat auch zur Konsequenz, daß diese Figuren nicht mehr zur Identifikation einladen. »Identifikationsfiguren der schematische Art sind bei mir nur Strotter und Strotterinnen. Der stumme Chor der mit dem Leben Geschlagenen.« (Streeruwitz 1997, 75). Gerade diese antiidentifikatorische Lektüre ist ein bestimmendes Merkmal für die Literatur der neunziger Jahre. In diesen Texten geben Leser und Autor nicht mehr wechselseitige Unterstützungserklärungen ab, ja das Verhältnis der beiden wird auch nicht durch Ironie gestützt: Wir sollen uns mit keiner dieser Figuren auf der Bühne identifizieren, wir sollen in keinem Falle diesen Gestalten nahekommen dürfen.
Noch ein Moment ist bei der Lektüre dieser Stücke zu berücksichtigen: Es soll ein Radikangriff auf die Sprache gestartet werden. Daher. Betrachtet man die Sprache als eine Manier, auf die man sich geeinigt hat, so bedarf es einer Gegenmanier, um diese Manier außer Kraft zu setzen. Und das wird in diesen Texten mit einer Gründlichkeit besorgt. Das Wesen dieser Texte ist der Punkt, ein Zeichen, das sich freilich beim Sprechen so leicht nicht aussprechen läßt; mit anderen Worten: Wir müssen bei den Stücke auch die Partitur mitlesen – aber daß es Lesedramen seien, wollen wir so mir nichts, dir nichts doch nicht behaupten. Das Fragment soll gegenüber dem ganzen, in sich abgeschlossenen Werk sein Recht erhalten und ihm gegenüber Recht behalten. »Mit dem Punkt kann der vollständige Satz verhindert werden. Der Punkt beendet den Versuch. Sätze sollen sich nicht formen. Nur im Zitat findet sich selig Vollständiges.« (Streeruwitz 1997, 76). In solchen Lapidarurteilen steckt die Stärke der Autorin. Manchmal hat man den Verdacht, es müßte das Rad noch einmal erfunden werden, so verblüffend einfach liest sich das alles. »Keine Zuflucht, sich ein Sätzchen mit nach Hause zu nehmen und in Kreuzstichmuster aufzuhängen.« (Streeruwitz 1997, 76). Solcherlei verdient denn auch hervorgehoben zu werden, weil es weit über diese Autorin hinaus auf größere Zusammenhänge verweist: Diese Literatur ist nicht da für das Merken; sie kennt den Merkvers, die Sentenz, die Gnome nicht, ja die Sätze sperren sich dem Gemerkt-Werden. »In dem, was nicht gesagt werden kann. Oder nicht gesagt werden darf, bleibt jeder und jede allein. Jeder schweigt ein anderes Schweigen.« (Streeruwitz 1997, 76). Auch das ein wichtiger Hinweis, denn diese Dramaturgie ist auch eine Dramaturgie des Schweigens – jenes Mittel, mit dem es vor allem Thomas Bernhard vorzüglich verstand, Wirkung auszuüben. Man ist natürlich auch versucht, an Thomas Bernhard zu denken, der in seinen Stücken fast immer eine Figur benötigt, die schweigt – eine unabdingbar notwendige Kontrastfigur zu den dauernd redenden Raisonneuren.
Die Stücke der Marlene Streeruwitz zwingen die Kritiker zur wortreichen Kapitulation. Am besten und als Anstoß für den Diskurs um die Stücke der Autorin ist wohl das Vorwort von Elfriede Jelinek zu der Ausgabe der Stücke von 1999 geeignet.
Ich will doch auch der Autorin Streeruwitz vorher noch ein wenig am Zeuge flicken. Wenn sie ihre Stücke geometrisch so schwer faßbar nennt und den Inhalt als unbeschreibbar bezeichnet, so heißt das ja noch lange nicht, daß man einen beliebigen Titel. Ich finde es immer noch besser, daß Hamlet Hamlet heißt und nicht Beppo Mauhart. Aber, so das Credo der Autorin: Was geschieht nun, nachdem im Osten die Systeme zerbrochen sind und im Westen sich unter dem Patriarchat die neue Macht wieder aufbaut? Unsere Prägungen haben bis heute unsere Seelen kolonialisiert und genau jene sprachleeren Kontinente in uns aufgebaut, die darauf warten, im entscheidenden Augenblick gefüllt zu werden. Mit der Sprache des Patriarchats. Mit den Aufträgen. Und. Von unserer Erziehung sind wir all das losgeworden, was früher deren Inhalte ausgemacht hatte. Wir sind »ohne direkte Väter« (Streeruwitz 1998, 16). In dieser Situation der Ahnenlosigkeit geht es darum, die Dinge neu zu benennen. Es gibt keine Ordnungen, auf die man aufbauen und von denen man ausgehen könnte. »Es liegen Wahrnehmungsmuster unter den Informationen, denen unsere eigentliche Aufmerksamkeit gelten muß. Sie transportieren ungesehen die Grammatik des Patriarchats.« (Streeruwitz 1998, 23) Aufschlußreicher als die Beobachtung, daß das Patriarchat allenthalben wirksam wäre, scheint mir der Denkansatz an sich zu sein: Was transportieren die Informationen in der Tat, wenn sie nicht nur Informationen sind? Was für Muster liegen diesen Informationen zugrunde? Um dies aufzudecken, setzt sich der dramatische Apparat in Bewegung, allerdings wäre es verfehlt, hier von einer Enthüllungsdramatik in der Art Ibsens zu sprechen: es geht vielmehr darum, Machtstrukturen (und der Gedanke an Canetti liegt nahe) aufzubrechen.
Allerdings können diese Stücke nicht »übersetzt« werden in eine diskursive Sprache; das macht ihre Leistungen aus, und darin liegt auch ihre Stärke. »Und diese Unbeschreibbarkeit dessen, dem wir alle unterliegen, macht ihr Stücke gleichermaßen konkret wie vollkommen rätselhaft.« Das ist ein notwendiges und auch verblüffend ehrliches Bekenntnis, weil daraus in aller Deutlichkeit die Ratlosigkeit als eine Figur der Einsicht und auch der Erkenntnis spricht. Die Stücke zeigen eben den Machtabtausch; wie die Ohnmächtigen Macht ausüben und die in der Tat Mächtigen sein können. Zum anderen gibt es auch die jäh machtvoll auftretenden Herrscher (Gaviria, der Rauschgifthändler) in Ocean Drive, der sich in Versen in seiner Macht ergeht.
Marlene Streeruwitz: Ocean Drive
Ocean Drive gehört in gewissem Sinne noch zu den »einfacheren« Stücken, weil es von einem ganz einfachen Kalkül ausgeht: Da sitzt eine Schauspielerin in einer Bergidylle (Elizabeth Maynard) und ein Starjournalist (Leonard Perceval) kommt, um sich als Biograph an sie heranzumachen. Sie 55 bis 60, er etwa um die vierzig. Natürlich gibt der Familienname des Journalisten (Perceval) sofort zu denken: Wieder so einer, der sucht – noch dazu im Schnee. Aber es wird mit dem Parsifal schon noch besser kommen! Der Hauptteil wird von dem Gespräch der beiden eingenommen. Der Journalist soll eine Biographie der Frau schreiben – er ist schon gut informiert: Die Biographie darf kritisch sein, aber die Diva will die Endfassung noch vor der Veröffentlichung korrigieren. (vgl. Streeruwitz 1999, 171) Aus dem Gespräch geht hervor, daß beide abhängig sind von mehr oder weniger anonymen Gruppen, die über sie verfügen, die jede individuelle Bewegung der Figuren kontrollieren – selbst hier oben im Bergidyll, am Rande des Gletscherfeldes. Die Diva putzt sich natürlich vor dem Journalisten heraus – sie könne keinen Alkohol mehr trinken, so läßt sie sich vernehmen, aber den roten Saft, den sie ihm anbietet, kann er nicht trinken – und wenig gefühlvoll leert er den Trank in den Schnee. (vgl. Streeruwitz 1999, 173) Er handelt gleichsam unter dem Zwang, den ihm sein literarisches Vorbild diktiert: Auch Parsifal hatte es mit Rotem im Schnee zu tun, wie wir wissen. Er wühlt dann im Schnee, um dieses Rot zu bedecken. Ab der dritten Szene kommt eine Rätselfigur auf die Bühne, und zwar der Yeti. Auch schlägt die Autorin dem um Identifikation bemühten Leser ein Schnippchen, denn dieser Yeti ist natürlich alles andere als ein Yeti, er ist auch aus der Literatur zu uns gekommen, und zwar ist »Graf Karl Bühl für den 2. und 3. Akt des Schwierigen in Abendkleidung« (Streeruwitz 1999, 166), eine gewiß kuriose Kombination, wird man nicht ohne Grund feststellen können. Das wird uns noch an anderer Stelle beschäftigen. Er taucht zunächst nur einmal so am Rande auf, ebenso der Zwergenforscher Severini. Ihrem Auftreten oder Abgehen eignet keine wie geartete Notwendigkeit. Die Heldin hat eine Vergangenheit, natürlich auch eine österreichische Vergangenheit; (vgl. Streeruwitz 1999, 176) viele Ehen hat sie hinter sich gebracht, sie ist mehrfach geschieden und einmal verwitwet. Ende der 70er Jahr galt sie als »Inbegriff der Verführung« (Streeruwitz 1999, 176), was immerhin die Vermutung nahelegt, daß dieses Stück in der Zukunft spielt, zumindest nicht in der Zeit da es uraufgeführt wurde (1993), denn dann wäre sie mit etwa Mitte vierzig der »Inbegriff der Verführung« gewesen, was möglich, aber nicht unbedingt glaubhaft ist. In der vierten Szene taucht ein Straßenarbeiter auf, der unverkennbar tirolerisch spricht und seelenruhig seinen Pfosten einschlägt, was die Diva irritiert, denn der Berg gehört, wie sie meint, ihr (vgl. Streeruwitz 1999, 180); ungerührt verläßt der Straßenarbeiter die Szene – ihn interessieren offenbar die Berühmten nicht. Streeruwitz variiert hier ein Thema, das Thomas Bernhard in seinem Stück Die Berühmten (1976) ins Zentrum gestellt hatte: Die Stars, durch die sich die Menge mit Hilfe der Abgrenzung definiert und an der sie doch auch Anteil haben möchte. Seine Worte »Heint ischt Dunnerschtag. Ja. Heint ischt Dunnerschtag«, die er geradezu ungerührt repetiert (Streeruwitz 1999, 179-181) zeigen an, wie wenig die Zeitgenossen sich um das kümmern, was in der Öffentlichkeit diskutiert zu werden scheint. Der Besitzanspruch, den der Star auf diesen Berg erhebt, wirkt lächerlich. In der VI. Szene kommt das dünne, in der VIII. Szene das dicke Ehepaar – eben jene Meute, die um die Stars weiß. Ihre Haupttätigkeit ist jedoch das Deponieren des Mülls, den sie von unten herauf gebracht haben: Das dünne Ehepaar spricht in einem »resigniert-raunzigen Ton«; (182) gedankenlos machen sie in ihren Rucksäcken Ordnung und ziehen Müll heraus, »Getränkedosen, Verpackungen, Taschentücher«, um sie in den Schnee zu werfen. (Streeruwitz 1999, 182) Ähnlich verfährt das Dicke Ehepaar, dieses wirft den Müll »aggressiver und bewußter als dünne Ehepaar« weg. (Streeruwitz 1999, 186) In diesen kurzen Szenen hat Streeruwitz satirisch das ganze Elend des kleinbürgerlichen Tourismus eingefangen. Mit einer peinlichen Suada dient sich die dicke Frau der göttlichen Schauspielerin an, die auch für ihre Diätkochbücher berühmt ist. Nach diesen mehr oder weniger vorbereitenden Szenen, die revueartig wirken und kaum eine Handlungsdynamik entfalten, kommt mit der X. Szene Bewegung in das Ganze: Der Zwergenforscher Severini, der Entwicklungshelfer und Pozzo betreten die Bühne. Pozzo ist ein Delinquent mit rötlichem Haar, der vom Bewacher geführt wird. Der Entwicklungshelfer (er erinnert eher an einen Sozialarbeiter) versucht, die Schauspielerin über seine Weltanschauung aufzuklären, was natürlich nicht gelingen kann, denn dieser gute Mensch versagt in der Höhenluft der High society. Mehr noch – er wird zum Opfer, denn Pozzo läuft davon, auf das Schneefeld, der Entwicklungshelfer wirft sich über ihn, und beide werden vom Bewacher erschossen; die Leichen werden dann von der Gruppe beiseite geräumt: Nun sind die roten Spuren im Schnee echtes Blut (vgl. Streeruwitz 1999, 194). Elizabeth und Leonard kommentieren das Ereignis höchst beiläufig. Diese Welt ist offenkundig eine Welt der Befehle, wer einen Befehl hat, der kann auch erschießen, die Diva weiß das. Doch dann werden sie von dem Auftritt des Yeti unterbrochen, der sich nun – Leonard und Elizabeth werden zur Stummheit verurteilt – in der XII. Szene mit dem Zwergenforscher ausgiebig unterhält. Der Kommentar in den Regieanweisungen ist wichtig: »So hätte Livingstone Stanley begrüßt«, heißt es da (Streeruwitz 1999, 195): Vollendet Formen in einer Extremsituation. Der Yeti sagt nun auf, wie es mit dieser Gesellschaft weiterging, nachdem das Stück Der Schwierige vorüber ist und Hans Kari seine Helene gekriegt hat, denn von dieser feinen Dame der Aristokratie ist nun die Rede. Was Graf Bühl als Yeti von sich gibt, ist – im Klartext – eine Abrechnung mit dem österreichischen Erbe. »Wir haben nur das Beste gewollt« (Streeruwitz 1999, 196), weiß der Yeti zu verkünden, aber es hat die Katastrophen des Ersten Weltkriegs gegeben, den man überlebt hat, und in denen die Kinder zugrunde gegangen sind – man war selber dabei, wie diese Höllen angeheizt wurden. Die Rede des Yeti karikiert die Rede, in der die versunkene Welt der Monarchie zur frommen Legende wird. Helene, die »Helén« (Streeruwitz 1999, 196), hat sich gemausert: »Die Helene verwaltet Göllersdorf. Das macht sie sehr gut. Ich glaube. Sie haben einen Golfplatz da.« (Streeruwitz 1999, 197). Das ist die unbedachte Rede der Vornehmen über die Aufgabe der Beamten, über den Alltag, über das, das was Hofmannsthal das »Sociale« nannte. Der Aristokrat ist ein Rätselwesen, so seltsam und so unwirklich wie ein Yeti; in diesen rätselhaften Zustand, der aus der (Zeitungs-)Phrase geboren wird, scheint der Yeti verbannt: Ein irreales Wesen, ein Wesen aus Worten, und als solches doch wieder existent. Der Zwergenforscher will ein Photo machen, aber der Yeti ist schon auf und davon – er läßt die »Mamà« schön grüßen. (Streeruwitz 1999, 201) In der XIII. Szene wird der kleinbürgerliche Tourismus gefährlich: Das dicke und das dünne Ehepaar betritt die Szene – sie kommen zum Yeti-Schauen und haben ihre Hunde (Prometheus, Parzival, Odin und Burli) mitgebracht – das ist aus dem Mythos, im besonderen aus dem eines Richard Wagner im Kleinbürgertum geworden: Hunde mit Namen. Wütend zieht nun das dünne Ehepaar ab – es hat kein Autogramm bekommen. Der Star ist nun alles andere als gnädig. Die kleinbürgerliche Empörung wird durch die Wucht der nächsten Szene weggespült: Eine Maschinengewehrsalve kündigt die Ankunft eines neuen Machtmenschen an: Während das Knurren der Hunde andauert, hält der Rauschgifthändler Manfredo die Jesus de Gaviria seinen Monolog, und weil er ein Theaterheld ist, spricht er in Versen, und zwar in vierfüßige Trochäen. (vgl. 208ff.) In dieser grande scène offenbart sich am besten das dramaturgische Geschick der Autorin. Wir sind, das merken wir, nun in einem Zauberspiel oder Märchenstück. Gaviria, der Rauschtgifthändler, verhält sich so, als wäre er der Herr der Welt: Er möchte sich mit Elizabeth verbrüdern und mit ihr die Welt beherrschen. Er ist der ungekrönte Herrscher der Welt, denn von ihm sind die Regierungen abhängig. Der Rauschgifthändler, so lese ich es, ist die Allegorie des Neokapitalismus. Der Berg gehört schon zur Hälfte ihm, nun will er auch die Frau, die seinen Glanz erhöht. Es ist ein äußerst gelungener Trick, diesen Gaviria nun in seiner metrischen Rede gleichsam auf einer anderen Ebene in das Stück einzubringen, und als schnöden Repräsentanten der Macht diese jedoch durch das Versmaß zu verbrämen. Dann zieht dieser seltsame Machtmensch ab – wir erkennen vielleicht, daß es ihm, sieht man vielleicht vom geschäftlichen einmal ab, nicht ganz ernst ist – aber auf den Glanz der Diva fällt ein Schatten: Sie verdient auch am Glücksspiel mit, und das empört dann unsere Kleinbürger. (Streeruwitz 1999, 214) Natürlich ist der dunkle Punkt in der Biographie Elizabeths nicht uninteressant für den Biographen, aber es kommt doch – nach mehreren Umwegen – zu einer anderen Entwicklung: Eine Hochgebirgsrobinsonade scheint bevorzustehen, denn der Hubschrauber kommt nicht. Man bedient sich nun der im Schnee abgekarten, findet Briefe beim Entwicklungshelfer und ein Schweizer Messer. Das ist das fatale Requisit. Es kommt, wie es kommen muß: Die reife Elizabeth und der vergleichsweise junge Leonard beginnen eine Affäre, es kommt zu einem »Filmkuß« (Streeruwitz 1999, 224), aber Elizabeth hat Schwierigkeiten – sie hat das, wie sie sich ausdrückt, »verlernt«, sie kann nicht mehr nett sein. (Streeruwitz 1999, 225) Sie singt dann noch eine feministische Arie: Ich wollte, daß kein Mensch sich mehr von mir erholt. Ich wollte. – Eine Brandmarke im Fleisch derer, die mich. Zerstören, die mich immer zuerst. Denen ich gut war und denen es. Ausgenützt. Nie genügt. Nie genug. Immer weniger, als ich. Eine Leere wollte ich sein, über der sie zusammenbrechen. Und weinen müssen. Bis an ihr Ende. So. Wie sie es mir beigebracht. Und jetzt habe ich es selbst nicht mehr. (Streeruwitz 1999, 226) Eine Rachearie, allerdings steht die Rache bereits im Zeichen der Resignation – der kräftige Wille scheint ins Imperfekt versetzt. Die letzte Szene zwischen Mann und Frau gehört zum feinsten, was moderne Dramaturgie zu bieten hat. Ich kann den subtilen Dialog nicht in allen Einzelheiten nachzeichnen, sehr wohl aber schiene es mir angebracht, diese Szenen ganz auszuspielen: Hier wird ein Liebesdialog in allen seinen Windungen, seinen Widersprüchen ausgeführt. Und das Ende ist fatal. Leonard fällt auf, daß Elizabeth das Schweizer Messer umklammert hält. Dieses Schweizer Messer ist eben, wie gesagt das fatale Requisit: Es ist einem Toten abgenommen und es bedeutet Tod. Der am Ende schrecklich naive Leonard beginnt von einem neuen Leben zu schwärmen. Das gehört zur männlichen Überzeugungsrhetorik – zu sagen, daß man von sich aus das Verhältnis der Geschlechter völlig neu zu definieren beginnen wolle. Und da macht Elizabeth nicht mehr mit: Elizabeth dreht sich ihm langsam zu. Sie sticht ihn mit dem Schweizer Messer ins Auge. Langsam und erstaunt über das, was sie tut. Er sinkt getroffen nieder. Er schreit nicht, stöhnt, aber eher erstaunt. Bleibt liegen. Das Messer steckt in seinem Auge. Kein Blut. Elizabeth versteinert. (Streeruwitz 1999, 231) Natürlich versucht sie in der Folge, die Leiche auch im Schnee bei den anderen Leichen zu deponieren. Der Yeti kommt und hilft ihr – der Schluß dann wieder echt filmisch: Die Tat ist, wie der Yeti, alias Graf Bühl, weiß, von einer Videokamera aufgenommen worden. »Es warten alle auf Sie. Gnädige Frau«, verkündet der Yeti – die Show geht weiter. (Streeruwitz 1999, 232) Wir werden allesamt dabei gefilmt, wenn wir den Müll, auch den Menschenmüll deponieren. Streeruwitz' »Kinder der Toten« lagern in diesem Falle hoch oben im Schnee. Natürlich kann keine dieser Szenen für sich beanspruchen, daß es sich um ein reales Szenario handelte: Es gibt auch einigen Klamauk, so als ein Bewacher den Delinquenten Pozzo und einen Entwicklungshelfer, der sich auch in diese Gletscheridylle verloren hat, erschießt und dann die Leichen abschleppt. Am Ende wird Leonard von Elizabeth erstochen – mit einem Schweizermesser ins Auge hinein. Man kann nicht sagen, daß diese Tat von langer Hand motiviert worden wäre. Zwar ist vom Schweizermesser vorher ausgiebig die Rede, aber eine echte dramaturgische Funktion hat dieses Gerät doch auch nicht. Wenn wir diesen Text charakterisieren wollen, so haben wir noch kaum das literaturwissenschaftliche Material dazu zur Hand. Gewiß nährt er sich von der Avantgardedramaturgie dieses Jahrhunderts, die gleichsam aus allem etwas herbeizuzitieren vermag: In der Bergidylle verkündet der Graf, was aus ihm so im Lauf der Jahrhunderte geworden ist; die Helene (Helèn) kümmert sich nun um Göllersdorf – offenkundig ist die echte Noblesse von früher nun karitativ tätig. Da erkennen wir das Wiener Konversationsstück, während wir in dem Auftritt des Gaviria, des Rauschgifthändlers, eben das spanische Drama vermuten, unzählige Zutaten aus Filmen werden eingesetzt. Mitunter kommt auch der lockere und leichte Tonfall des Volksstücks auf, das Burleske; wir wissen, daß es Theaterblut ist, das da vor uns verspritzt wird. Das ganze Stück zehrt von dem Pathos, das es denunziert und zu dem es sich doch dann bekennt, wenn es um die Geschichte der Frau geht, die sich aber selbst als Gefangene dieses Pathos erkennt und von da an nicht mehr kritisch in den Ablauf eingreifen kann oder will. Die Suspendierung jeder Handlung, die eine dramatische Kohärenz aufwiese, ist Programm. Ich meine, daß man das nicht dem Stück anlasten sollte, sondern daß vielmehr eine solche Kohärenz in einem klassischen Drama eben auch nur ein Schein ist, den es mit mehr oder weniger drastischen Mitteln aufrecht zu erhalten gilt. In jedem Falle ist mit den Dramen Jelineks, Streeruwitz' und Werner Schwabs ein ganz neuer Tonfall, eine neue Dramaturgie des Schreckens, auch des Häßlichen auf die Bühne gekommen, ein Verschnitt verschiedener dramatischer Situationen und Traditionen, die ein völlig neues Konglomerat ergeben. Auch Handkes Stücke der letzten Jahre gehorchen nicht mehr einer Entwicklung; es geht um die isolierten Szenen, die oft für sich Eigenleben beanspruchen können, um die Situation an sich, die sich als eine exemplarische entfaltet.
Michael Scharang: Das Jüngste Gericht des Michelangelo Spatz (1998)
Wenn in einer Schule für Dichtung die Kunst des Romananfangs gelehrt wird, so ist guter Rat billig: Beginnen Sie den Roman mit einer Ankunft in New York, das ist schon die halbe Miete. Freilich kommt es dann darauf an, was man daraus macht, und Michael Scharang (*1941) macht ohne Zweifel sehr viel daraus. Wir sind meinen Berechnungen nach an der Jahreswende 1994/95: Der namenloser Ich-Erzähler nimmt Urlaub von seinem Posten im Wiener Völkerkundemuseum, um den Hund, genauer: die Hündin seiner Geliebten Maria zu betreuen. Das ist der burleske Einstieg, und wir dürfen den Erzähler bei seinen abenteuerlichen ersten Erlebnissen in New York, genauer Manhattan, noch genauer: Washington Square und Umgebung folgen. Aus der Fülle der Episoden verdient das flotte Finale Erwähnung: Der Erzähler lernt den österreichischen Komponisten Michelangelo Spatz kennen. Man beschließt, einer Fernsehstation eine Serie aufzuschwatzen mit dem Titel: »Das Jüngste Gericht des Michelangelo Spatz« – sehr beziehungsvoll, denkt man an den Vornamen des Herrn Spatz. Gemeint ist, daß nun, nach dem Zusammenbruch des Kommunismus im 1989, dem Westen der wahre Feind abginge: Daher stünde nun, weil man keine Kräfte gegen etwas organisieren müsse, nur mehr das Ende, das Jüngste Gericht bevor. Es geht apokalyptisch zu, es geht postmodern zu. Spatz ist aber auch kein solider Geselle – er lockt der Fernsehgesellschaft $ 100.000 für das Projekt heraus, das allerdings von ihm und dem Erzähler nie fertiggestellt wird. So bleibt nur die Flucht; dem Erzähler gelingt sie, er kommt zurück nach Wien, wo seine Geliebte Maria die Sache saniert: Sie ist durch verschiedene Erbschaften so reich, daß die Aufbringung der Summe kein Problem für sie ist. der Roman schließt mit einer Parabel in Brechtscher Manier, deren Tendenz sich in etwa so zusammenfassen läßt: Wer in den echten Genuß der Güter vom anderen Ufer des Flusses kommen will, der schwimmt über diesen und braucht keine Brücke; er freut sich aber nichtsdestotrotz, daß es eine gibt – über sie können die gehen, die sonst über den Mangel an Genuß kommen. Gemeint ist das Fernsehen und andere Errungenschaften, die symbolisch für den immer fragwürdigeren Fortschritt in einer zusehends fragwürdigeren kleinbürgerlichen Gesellschaft stehen. Doch wäre mit einer so platten Auflösung die moralische Tendenz Scharangs Romans nur unzulänglich charakterisiert: Aus dem New Yorker Rückspiegel trifft er die österreichische Gesellschaft und ihre monströse Selbstsicherheit, und weil das satirische Salz so feinkörnig geworden ist, schmerzt es in den österreichischen Wunden sicher mehr als es die Romane realistischen Zuschnitts vom Schlage eines Charly Traktor im Jahre 1976 vermochten. Seine Kritik an der Vorliebe unserer Medien für apokalyptische Szenarien trifft voll ins Schwarze des postmodernen Bewußtseins. Aber auch die Gesellschaftskritik, und sei sie noch so triftig, garantiert ja nur selten Lesbarkeit. Scharang weiß, womit er seine Leser unterhalten kann, und besorgt das souverän: New York sei ein Ort für Zufälle, und der Autor bedient sich dieses Mittels, das im Unwahrscheinlichsten Glaubhaftigkeit suggeriert. Er verknüpft verschiedene Episoden, macht seinen Helden zum Zaungast des Glücks und Unglücks und läßt ihn, wie alle Schelme von Rang, am Ende glücklich entkommen. Indes einen einzigen Schönheitsfehler hat dieses Buch für mich: Es knüpft an Scharangs letzten Roman von 1992 Auf nach Amerika an – ein Kabinettstück übrigens, das diesem neuen Roman ebenbürtig ist –, und um die Verbindung herzustellen, wird vieles einfach noch einmal erzählt, was schon im Vorgänger zu haben war. Das ist freilich für den, der das erste Buch nicht kennt, notwendig, dem jedoch, der dieses noch im Gedächtnis hat, kommt manches wie eine Doublette vor. Wie dem auch sei, ein rundes Ganzes ist doch auch aus diesem Buch geworden, eine erfrischende Lektüre mit vielen amüsanten und grotesken Episoden. Ein Gespräch mit einem amerikanischen Universitätsprofessor enthält für mich die bislang beste Charakteristik der in den USA üblichen Rhetorik bei Leuten dieser Profession, einer Rhetorik, die Akademisches und Privates verquickt und beides mit einem Heiligenschein aus Phrasen versieht, der die Realität schamlos verklärt. Auch der schmucklosen Darstellung sexueller Praktiken wird Raum gegönnt; sie lassen an Brisanz die neuesten Nachrichten aus dem Weißen Haus weit hinter sich. Ein realistischer Roman ist das nicht, sehr wohl aber ein heiteres Buch, in dem der Held mehr durchmacht als ihm zuträglich ist, ein Roman der Aufklärung, vom Schlage des Voltaireschen Candide, dessen Welterfahrung sich in einem Orte versammeln läßt, eben in New York. Der Mangel an unterhaltsamer und welthaltiger Literatur aus dem deutschen Sprachraum wird oft beklagt; dieses Buch taugt als Gegenbeispiel, und es löst die Forderung der Aufklärung ein: zu unterhalten und läßt doch nie die Ansprüche vergessen, denen die Literatur es verdankt, daß sie auch ernst genommen wird.
Werner Schwab
Der 1958 geborene und in der Silvesternacht 1993 verstorbene Werner Schwab stellt uns mit seinem Bühnenwerk vor ähnlich schwierige Probleme wie Marlene Streeruwitz; doch die Unterschiede springen sofort ins Auge. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Schwabs Dramen steckt in den Kinderschuhen; in jedem Falle sei angemerkt, daß Schwab zu Beginn der neunziger Jahre jäh für Texte berühmt wurde, die er erst knapp vorher geschrieben hatte. Dieser kurzen Serie der Erfolge waren Jahre intensiver, aber erfolgloser Arbeit (auch als bildender Künstler) vorangegangen. Der Blick auf die Schriften Ernst Jandls und der Marlene Streeruwitz vermag unser Sensorium für die Leistung Schwabs zu schärfen. Wir sind in jedem Falle auf eine Literatur vorbereitet, die den Anspruch des mimetischen nicht vor sich her trägt. Die Texte Werner Schwabs fügen sich sehr gut in die hier mit Namen wie Jelinek, Jandl und Streeruwitz angedeutete Entwicklung. Ich versuche das an einigen Beispielen in Kürze darzulegen. Die extreme Künstlichkeit der Figuren, die sich am deutlichsten in ihrer Sprache niederschlägt, ist ein entscheidendes Moment. Diese Künstlichkeit der Figuren wird am schönsten in der »Cover-Version« von Arthur Schnitzlers Reigen manifest erschien 1996 und basiert auf einem zu diesem Werk Schnitzlers dramaturgisch verwandten Prinzip: Zunächst einmal sind es die Figuren. Es sind zusammengesetzte, »synthetische« Figuren, die aus der Welt Schnitzlers in die unsere herübergerettet sind. In jeder Szene vollzieht sich der Geschlechtsakt – aber wie! Was bei Schnitzler nur zart – und das in Gedankenstrichen – angedeutet wird, das wird bei Schwab voll ausgespielt. Zunächst einmal die Abfolge: Angestellter-Hure; Angestellter-Friseuse; Friseuse-Hausherr; Hausherr-junge Frau; junge Frau-Ehemann; Ehemann-Sekretärin; Sekretärin-Dichter; Dichter-Schauspielerin; Schauspielerin-Nationalratsabgeordneter; Nationalratsabgeordneter-Hure. Zum Vergleich dazu Schnitzlers Reigen: die Dirne-der Soldat; der Soldat-das Stubenmädchen; das Stubenmädchen-der junge Herr; der junge Herr-die junge Frau; die junge Frau-der Ehemann; der Gatte (Ehemann)-das süße Mädel; das süße Mädel-der Dichter; der Dichter-die Schauspielerin; die Schauspielerin-der Graf; der Graf-die Dirne. Um zu verfremden, ist Schwab keine Derbheit fremd. Allerdings sind diese Figuren nicht mehr sich selbst identisch; ihre Sexualität ist ihnen nur äußerlich, sie kann abgenommen werden. Die Freude am Geschlechtsakt wird bloß simuliert, ganz anders als eben bei dem reizenden Herrn Schnitzler: »Alle männlichen Figuren haben abschraubbare Geschlechtsteile. Alle weiblichen Figuren haben austauschbare Muttern.« (Schwab 1996, 4; vgl. auch 11, wo der Angestellte »seinen kleinen Plastikschwanz« aus der Hose herausholt.) Die Sprache ist zum einen von innen her koordiniert, zum anderen quillt sie über von neuen Wendungen, Komposita und Bildern. Der Dialog präsentiert sich als Unsinnsdialog, und jeder Dialog, der sich zu einer Interlinearversion in der Originalsprache herbeiläßt, untergräbt alle Chancen der Lektüre etwas abzugewinnen, etwa der Dialog von Dichter und Sekretärin:
DICHTER War der Zauber des Spaziergangs in den Resten der Natur nicht totalitär zauberhaft, mein süßer Lieblingsschatz? (Küßt sie.) Hm, und wie du duftest an dir, wie eine frisch umgegrabene Erdscholle. SEKRETÄRIN Was ... aber ich stink' doch nicht wie ein Fisch. DICHTER (lacht) Aber ich meine doch nicht die Scholle als Fisch. Komm, leg dich doch auf den Diwan, du herrliches Filet. SEKRETÄRIN Aber ich bin doch bei gar keiner Schwäche einer Müdigkeit angelangt. DICHTER Ich bestehe auf deiner Müdigkeit. Die liegende Sanftlage wird dich erquicken. SEKRETÄRIN (lehnt sich zurück) Müde bin ich gar nicht, aber einen Appetit habe ich gerade gespürt. (Schwab 1996, 39)
Natürlich bezieht der Dialog seinen Kontrast aus der Naivität der Sekretärin und dem abundanten Geschwätz des Dichters. Die Stelle könnte man auch als einen »Schwab für Anfänger« bezeichnen. Auf der anderen Seite entsprechen die Figuren dem Klischee, dem auch Schnitzlers Figuren entsprechen; ja man könnte sogar von einer »Übererfüllung« dieses Klischees sprechen. So etwa in der gleichen Szene, in der sich der Dichter präsentiert. Die Abweichungen von der Normsprache sind scharf markiert:
DICHTER Was glaubst denn du in dir, du luftiges Hascherl? Erkennst du überhaupt den Namen, den ich mir gegeben habe für die Nachwelt? SEKRETÄRIN Naja, Hans heißt' halt. DICHTER Das ist der Name meiner Geburt, aber was geht mich meine Geburt an? SEKRETÄRIN: Dann sag' halt, was deine Lust für einen Namen hat mit dir. DICHTER Ha (er richtet sich auf und verschränkt die Arme), behüte dein armes Gehirn vor dem Klangschreck meines Namens. Ich sage nur: Nestory. Man spielt mich in der Josefstadt. (Schwab 1996, 42f.)
Sich mit einem Dichter namens »Nestory« zu identifizieren, bedeutet auch einen Akt der Kapitulation: Hier kann einer nicht mehr schreiben, hier ist einem die Gabe der Authentizität verwehrt. Das ist es auch, was alle Künstler- und Kunstfiguren Schwabs plagt: Sie können nicht mehr sie selbst sein, sondern müssen einem Rollenspiel gehorchen, und sind sich selbst der Rolle bewußt, von der sie sich ebenso hilflos wie ironisch distanzieren. Das hat natürlich Konsequenzen für die Regie, für die Dramaturgie. Alle Regieanweisungen zerstören von Anfang an diesen mimetischen Bezug. Es werden Orte aufgesucht, an denen der Zuschauer in keinem Fall sich befinden möchte. Das Ekel, das Fäkalische, der Müll treibt den Leser in die Opposition. In den Königskomödien zeigt sich dies bei Schwab. Man besehe ich etwa den Raumonders deutlich. In OFFENE GRUBEN OFFENE FENSTER. EIN FALL von Ersprechen aus den »Königskomödien« wird das besonders deutlich. Man beseh' sich den Raum: Die ersten vier Szenen spielen in einer möglichst x-beliebigen Wohnung, die niemandem gehört [...]. Die sechste und siebente Szene finden auf dem sogenannten Land statt. Ein Häuschen, ein Gärtchen, alles herrenlos, alles exemplarisch. Szene sieben und acht klingen in Schrotthaldenumgebung. Bezeichnend ist das Finale auf einer Schrotthalde. HOCHSCHWAB ist von einem ähnlich desperaten, ja destruktiven Verhältnis zur eigenen Sprache getragen. Wieder eine Regieanmerkung: »Der vorliegende Sprachduktus wird vom Komponisten und der Pianistin ironisch bis zur Auflösung benützt. Die anderen Personen schwimmen im „Original" des Sprachflusses.« (Schwab 1992, 65) Das Idyllische ist nur in der Form der Zersetzung, des Zerfalls vorhanden – ähnlich wie in Jandls Idyllen. Das Organische erscheint als das Fäkalische. Ich meine, daß es Schwab durch diese »Radikaldramatik« (Volker Klotz) in der Tat gelungen ist, eine neu und zumindest unverwechselbare Form des Dramatischen zu erschließen, etwas, das zweifelsfrei seine Vorbilder im Einzelnen hat, das aber in der Kombination der einzelnen Handlungs- und Sprachelemente als durchaus neu zu gelten hat. Die Handlung ist zwar suspendiert, aber immer dann, wenn man sie aufgegeben wähnt, stellt sie sich doch umso radikaler, ja erschütternder ein.
DIE PRÄSIDENTINNEN (1991)
Das trifft gewiß auf HOCHSCHWAB zu, vor allem aber auf DIE PRÄSIDENTINNEN, ein Stück, dem ich mich nun zuwenden möchte. Die Struktur dieses Stückes ist für mich am ehesten nachvollziehbar. Es kann sich auf Figuren mit einer beinahe peinlich festumrissenen Identität stützen, aber es ist zugleich von keiner Handlungslogik her bestimmt. Und doch hat es eine Handlung, die wiederum in sich als durchaus folgerichtig gelten kann. Der Titel ist wiederum ein typischer Untitel, eine Irreführung – es treten keinesfalls Figuren auf, die landläufig als »Präsidentinnen« gelten könnten. Im Untertitel nennt sich das Stück bescheiden »Drei Szenen«. Die Figuren sind eben genau so, wie man sich Präsidentinnen nicht vorzustellen gewillt ist. Die Anmerkungen erzeugen mehr Unklarheit denn poetologische Abklärung: »Das Stück handelt davon, daß die Erde eine Scheibe ist, daß die Sonne auf- und untergeht, weil sie sich um die Erde dreht; es handelt davon, daß nichts Funktion sein will, nur Zerstreuung.« (Schwab 1991, 13) Und doch spürt man dahinter eine Devise, die dem ganzen Geschehen eine Dynamik geben soll, die es von der üblichen Handlungsdynamik abhebt. Die Figuren sind die Sprache, die sie selbst erzeugen, sie sind Sprachfiguren. Das ist ein Merkmal, das sich in unterschiedlicher Ausformung in der österreichischen Literatur immer wieder feststellen läßt und deren Qualität auch nicht unwesentlich bestimmt hat. Nur aus dieser Überakzentuierung der Sprache, die die Figuren ja selbst sind, wird auch ihre soziale Identität präzise faßbar, denn dieses Stück rekapituliert das Elend der Frau, der österreichischen Frau, und zwar in einer Zeit, da sich diese gerade zu einer Selbstbestimmung aufraffen will. Zugleich aber wären wir auf einem Holzweg, wollten wir darin eine Variante des Naturalismus von Hauptmann bis Mitterer oder Turrini vermuten. Eher scheint mir die Linie nach rückwärts in Richtung Ödön von Horváth verlängerbar. Das Kleinbürgertum ist das Unentrinnbare schlechthin, und es zeigt sich – gleichsam durch Parthenogenese – fort. Erna, Grete und Mariedl sind fürwahr ein Trio infernal, und jede Szene bestätigt aufs neue die katastrophalen Bindungen, deren Opfer die Figuren sind. Sie sind untereinander hervorragend differenziert: Grete, die das höchste Sozialprestige hat; Erna, die die geschickteste Sachwalterin der Bosheit ist und die in ihrer tiefen katholischen Gläubigkeit jählings die bösartigste Grausamkeit erkennen läßt. Der Raum – eine »groteske Wohnküche« – ist ebenso wie Erna, ist so wie ihre Sprache. Grete ist die überlegene, sie kommentiert die Handlungsweise der anderen, sie ist moralisch und pragmatisch. Von Dialogteil zu Dialogteil wird die prekäre Existenz diese drei Frauen herausgearbeitet. Mariedl ist für meine Begriffe die Figur, die am nachdrücklichsten als Beispielfigur angelegt ist. Sie verkörpert – mehr noch als Erna – die österreichische Katholizität, die in der Erniedrigung ihre Vollendung zu finden meint. Erna hat sich »etwas geleistet« (Schwab 1991, 16), einen Fernseher und eine groteske Haube. Mariedl hingegen ist die bindungslose (Schwab 1991, 17), und das ist es, was Erna, die ja den reichlich problematischen und in seinem Sexualverhalten tief gestörten Hermann zum Sohne hat, denn auch vorwirft. Die Pelzhaube hat Erna von der Mülldeponie geholt. Der Polizist auf dem Fundamt hat ihr schließlich die Haube nach einem Jahr zugesprochen (Schwab 1991, 16) – der Österreicher und die Österreicherin wartet auf den Gnadenerweis, der von oben zu erfolgen hat. Das Sparen ist diesen Menschen in »Fleisch und Blut übergegangen« (Schwab 1991, 16), und diese Redewendung ist sehr wörtlich zu nehmen. Schwabs Sprachkomik lebt zu einem guten Teil von diesem Wörtlichnehmen, wie auch die Nestroys, wie auch die Jelineks. Die Erziehung der Kinder ist offenkundig schief gegangen, bis ins Fleisch und Blut. Gretes Tochter Hannelore dürfte ein ähnlich mißglücktes Ergebnis der Erziehung sein wie Ernas Herrmann. Immer wieder führt der Dialog auf »Fleisch und Blut« hinaus (vgl. Schwab 1991, 19) – so viel zur Charakteristik Hannelores, die in Australien lebt, ohne Eierstöcke, »wie ein Hendl« (Schwab 1991, 18). Das Hündchen Lydia ist Grete als einziges Objekt für die Zuwendung geblieben. Man beachte, wie wichtig der Prozeß der Nahrungsaufnahme, mehr aber noch wie wichtig der Prozeß der Ausscheidung ist. (Schwab 1991, 17; 21) Ich will mich hier nicht verbreitern und allen Feinheiten nachspüren, aber so viel sei doch festgehalten: Diese Literatur versucht, alles Organische so deutlich wie möglich, so schonungslos wie möglich zu thematisieren. Was als das Peinliche, das Obsolete, das zu banale gilt, das wird nicht nur zur Sprache, sondern auch zur Anschauung gebracht. Die Menschen sind seit Jahrtausenden – wohl auch zu ihrem Wohle – so konditioniert, das Fäkalische in der Sprache wie im Verhalten euphemistisch zu behandeln. Dieses Verhalten abzubauen, sind die Fäkaliendramen angelegt. Mariedls Fach ist das Fäkalische schlechthin. Sie wartet auf die Gnade, sie glaubt an die Erleuchtung, an den »inwendigen Stoß«. (Schwab 1991, 20) Sie ist die Inkarnation der »sancta simplicitas«, die außer in der Unterordnung kein Heil zu erkennen vermag, die in der Verrichtung der niedrigsten Arbeit das ihr Angemessene erblickt. Ihr Bekenntnis zu ihrer Tätigkeit macht auch diese unappetitliche Folge ihres Verhaltens bewußt. Einerseits sieht sie sich in der Tradition der Nachfolge Christi, andererseits akzeptiert sie die soziale Hierarchie als etwas Gottgegebenes. Mit diesen Frauen ist weder Staat noch Revolution zu machen: Erna und Grete trainieren mit Mariedl auch diesen Gestus der Unterordnung. In Mariedls Bekenntnis steckt ein gutes Stück theologischer Spekulation: Da kommen die Menschen aus den besten Häusern zu mir, wenn eine Verstopfung stattfindet. Da kommt die Mariedl in die feinsten Häuser hinein und wird überall freundlich behandelt. Mich würgt es halt auch wirklich überhaupt nicht, wenn ich hinunter greife in die Muschel, ich opfere das auf für unseren Herrn Jesu Christ der für uns am Kreuze gestorben ist. Die feinen Menschen aus den guten Häusern fragen mich immer, ob ich nicht Gummihandschuhe nehmen will, weil die haben einen guten Anstand und eine feine Erziehung. Aber die Mariedl sagt NEIN, weil wenn der Herrgott die ganze Welt angeschafft hat, dann hat er auch die menschliche Jauche erschaffen. (Schwab 1991, 22f.)
Es ist gleichgültig, ob sich Mariedl auch der theologischen Dimension ihrer Rede bewußt ist, aber die Einsicht, daß auch das Negative (»Jauche«) von Gott stammt und daher gut sein muß, ist ein Bestandteil thomistischer Argumentation, die solchermaßen zu einer totalen Akzeptanz der Welt, wie sie ist, führen muß. Ich möchte hier nicht im Detail wiederholen, wie Mariedl die Toilettenanlagen reinigt – es möge hier der Verweis auf das Theologisch-Hygienische genügen. Daß aber das Drama sehr wohl auch eine Sozialparabel ist, die die katholische Begründung einer Klassengesellschaft enthält, sei zumindest einmal angedeutet. Meisterhaft entwickelt Schwab den Zwist unter den drei Frauen, genaugenommen nur unter zwei Frauen, und zwar Erna und Grete.
Erna ist in ihrer Demutshaltung nicht so radikal wie Mariedl, aber sie praktiziert ihre Sparsamkeit gerade in dem Bereich, in dem es um »Fleisch und Blut« geht. Der Leberkäs ist ein Sonderangebot, das von einem Mann stammt, der nicht von ungefähr »Wottila Karl« (Schwab 1991, 29) heißt; dieser findet auch die Zustimmung Mariedls, weil er fromm ist und einen »starken Glauben« (ebda) hat.
Der Zwist, der plötzlich zwischen Grete (der Geschiedenen) und Erna (Der Frommen) entsteht (vgl. Schwab 1991, 32f.), legt sich so schnell, wie er entstanden ist: Mariedl versöhnt sie. (vgl. Schwab 1991, 34f.)
In der zweiten Szene befinden wir uns im Après des Festes. Mariedl hat auch die festliche Entgrenzung mitgemacht, und ihr »entfährt« ein Lied, dessen Sinn ihr nicht bewußt ist (Schwab 1991, 37). Wieder stimmt sie sich auf die Festtagsfreude ein, wieder gibt sie sich dem Schwärmen für ihre Tätigkeit hin, zugleich aber wird hinter ihren Worten die Ankündigung einer endzeitlichen Katastrophe erkennbar (Schwab 1991, 39).
Mariedls Verhalten wird immer kurioser, zuletzt schildert sie in einer Art Vision, was auf einem solchem Fest vor sich geht (Schwab 1991, 51-55). Sie selbst wird verzückt und fühlt die Muttergottes Nahe, eine Art Lourdes-Vision scheint sich einzustellen. Und da wird sie von den beiden andern sachgemäß geschlachtet (vgl. Schwab 1991, 55f.) – eine richtige Opferhandlung. Wieder »Fleisch und Blut« – ein Finale, das in seiner Drastik nur schwer zu überbieten ist. Schwab läßt allerdings noch eine revueartige Szene folgen, und zwar singen die »Original Hinterlader Seelentröster« (Schwab 1991, 58) ein unsäglich naives Lied, das in seiner Metaphorik bewußt blasphemisch sich in Gottesdefinitionen versucht.
Die Stücke Werner Schwabs verdienen, so meine ich, noch einläßlichere Untersuchungen. Sie bezwingen durch die dramaturgische Technik, durch die Grausamkeit, durch die ironische Distanz. Schwabs Stück sind ein entscheidender Beitrag zur Literatur der neunziger Jahre – sie bringen zur Sprache, was aus der Sprache eliminiert worden war. Vor allem die Tötung am Ende, da Marield zu dem Abfall wird, den sie aus den Toiletten der vornehmen Häuser sonst entfernt. Sie stirbt ähnlich lautlos wie der Journalist in Ocean Drive von Marlene Streeruwitz. Wie solche Taten und Vorgänge als Zeichen der Zeit zu lesen sind, möchte ich hier nicht einer vorschnellen Lösung zuführen. Daß der so radikale Bruch der Konventionen einem Programm entspricht, daß hier jemand nicht zum Morden verführen will, ist klar, daß aber das Krude, das Grausame an der Oberfläche liegt, das ist die böseste und deutlichste Botschaft dieser Texte. Zugleich macht er uns auf Gefahren aufmerksam, die an der Oberfläche und nicht im Hinterhalt lauern. Schwabs dramatische Konvention ist jenseits von Naturalismus, Symbolismus und experimenteller Literatur angesiedelt, jenseits der Alternative von Avantgarde und Traditionalismus, vor allem auch jenseits der Opposition von Komödie und Tragödie, ähnlich wie bei Thomas Bernhard, wobei jedoch nicht auf komische Effekte verzichtet wird. Wie keines der bis jetzt behandelten Beispiele – mit Ausnahme der Idyllen Jandls – wird in diesen Texten die Hinfälligkeit des Menschen und seine Metamorphose zum Fäkalischen bewußt gemacht, eine Botschaft, die sich von der Hinfälligkeit des Körpers nährt und ihm die Sprache abzugewinnen sucht, die dieser deprimierenden Voraussetzung unserer Existenz auch zu entsprechen vermag.
Wolf Haas: Komm, süßer Tod (1998)
Es ist nicht leicht, den Erfolg, der mit den Romanen des Wolf Haas (*1960) verbunden ist, zu erklären, noch schwerer, den Reiz zu beschreiben. Daß es sich hier nicht nur um eine flotte Unterhaltungsliteratur handelt, wird jedem, der sich darauf einmal eingelassen hat, sofort klar, daß es aber zum anderen doch auch Unterhaltungsliteratur ist, die sich auf das Genre des Kriminalromans verläßt, ebenso. Elfriede Jelinek hat die Eingangspartie von Komm, süßer Tod sogar in ihr Buch Jelineks Wahl. Literarische Verwandtschaften (1998) wie eben auch Partien aus Werner Schwabs Essay Der Dreck und das Gute. Das Gute und der Dreck (1992). Das bedeutet doch eine Anerkennung, die offenbar eine wertende Grenzziehung zwischen Kriminalroman und sogenannter seriöser Literatur nicht zulassen will. In der Tat hat ja auch der Kriminalroman sich längst zu einem Genre gemausert, über das man verächtlich nicht sprechen soll – allerdings ist er auch einigem Wandel unterworfen worden. Vor allem eines: Er nimmt sich selbst nicht mehr ernst. Schon lange wird im Kriminalroman das Problem von Gut und Böse nicht mehr verhandelt; es versteht sich, wenn man so will, von selbst. Der Kriminalroman interessiert nicht mehr als eine Übung in Sachen Ethik, sondern er ist eine Übung in Sachen Literatur. Ich möchte in meiner Behauptung sogar so weit gehen, daß ich sage, daß der Kriminalroman das Böse gut gemacht hat, indem er es sein Lebenselixier sein läßt. Das Verbrechen, ohne das sonst die Literatur nicht auskommen könnte – das Personenregister der Weltliteratur gleicht ohnehin schon bald einer Verbrecherkartei – wird im Kiminalroman harmlos. Es gibt ja im bundesdeutschen Fernsehen immer wieder Tatort-Filme, in denen dann (weil so ungesühnt sollte man über Verbrechen nicht sprechen) immer wieder ein Schuß Moral fällt, meist zum Ärger des Zuschauers. Gerade aber um diese Moral geht es in den meisten Romanen nicht. Natürlich ist Wolf Haas bei den großen Autoren dieses Jahrhunderts in die Schule gegangen, und ohne Raymond Chandler hätte der Kriminalroman kaum Chancen auf dem Buchmarkt der Gegenwart gehabt. Mit Chandler betritt auch ein neuer Detektivtyp die Arena. Wir kennen Sherlock Holmes, wir kennen den anständigen Belgier Monsieur Poirot und die liebenswerte ältere Dame Miß Marple. Das sind Maschinen in einer mehr oder weniger liebenswürdigen Menschenmaske, aber beileibe keine hart arbeitenden Detektive mit Fehlern, so wie er uns bei Chandler in der Gestalt des Philip Marlow entgegentritt. Auch die Detektive des schwedischen Autoren-Paares Maj Sjöwall und Per Wahlöö sind eher durch ihre Defekte bestimmt als durch ihre Tugenden. Daß sie komplizierte Rätsel lösen können, ist klar, aber das geschieht meistens im Finale, und da wirkt es eher beiläufig. Die Handlung eilt dem Ende zu, wir wissen gar, nicht, warum der Detektiv so agiert, wir folgen ihm als beunruhigt Lesende, um dann von ihm an einen bestimmten Punkt gebeten zu werden, wo uns dann haarklein erklärt wird, was wir eigentlich schon längst hätten wissen müssen, aber der Detektiv hat es uns nicht gesagt. Aber er will uns nicht blöd sterben lassen, und so erklärt er uns erfreulicher Weise alles noch einmal ganz genau. Das Ende ist meist ein ganz gewaltiger Auflauf – da rasen Autos durch die Großstadt, der Verbrecher wird verfolgt, wir sind hinter ihm her, der Detektiv ist in unsäglicher Gefahr, aber der zweite Detektiv oder einer, den sich der erste Detektiv gerade noch als Hilfskraft beibiegen konnte, der rettet ihn dann aus einer schier ausweglosen Situation. Vorher hat der Detektiv aber noch aus einem Zeugen, den man schlicht vergessen hatte, die wichtigsten Informationen sich besorgt, die den gordischen Knoten lösen. Gewöhnlich wird ein gewaltiges Komplott aufgedeckt, eine unerhörte kapitalistische Schweinerei, ein Kampf, der sich hinter den Kulissen abspielte, und die Identität der wichtigsten Protagonisten war nur eine vermeintliche. Was ich bis jetzt sagte, das paßt auf viele Kriminalromane der Gegenwart, die den Leser mit einer geschickt sich zu einem Höhepunkt steigernden Handlung bedienen. Es paßt auch auf Wolf Haas, der uns ja die Geschichte vom Kampf der Kreuzretter mit den Rettungsbündlern erzählt. Man läßt zuckerkranke Patientinnen und Patienten schnell ein Testament unterschreiben, hängt sie dann an eine Zuckerwasserlösung und kassiert. Das ganze wird durch einen Herrn namens Lungauer verraten, der mundtot hätte gemacht werden sollen durch einen Bohrer, den man ihm ins Auge trieb, aber er ist es nicht, er kann sich sehr wohl noch äußern, und er tut es auch, und so kommt denn die Wahrheit doch noch an den Tag. Allein im Besitze der Wahrheit kann aber Brenner, so heißt der Detektiv, auch die Aufklärung der Verbrechen nicht leisten – es muß noch eine spannende Verfolgungsjagd quer durch Wien geben, ein Lösung am Ende und den gräßlichen Tod des Hauptschuldigen. Es geht offenkundig nicht mehr um das »Whodonit«, es geht auch nicht um die Aufdeckung des Verbrechens, die sich durch ein kompliziertes erzählerisch-technisches Manöver herstellen läßt, also um die behutsame Überwindung der Widerstände, um die schrittweise Aufklärung der Verbrechen. Man braucht keine Scheu vor einer Zufallsdramaturgie zu haben, die das Geschehen mal in die eine, mal in die andere Richtung lenkt. Das alles hätte Haas' Roman mit vielen anderen Romanen gemein, aber es kommt doch darauf an, die besonderen Qualitäten dieses Schreibens (die in der geplanten Verfilmung meistenteils durch andere ersetzt werden müssen) zu charakterisieren.
Zunächst einmal der Detektiv. Er ist ein Detektiv auf eigene Faust; das kennt man aus den meisten Romanen – der eigenwillig recherchierende Detektiv gerät in Konflikt mit der Staatsgewalt, aber er setzt sich und seine individuelle Sicht der Dinge gegen die Bürokratie durch. Das Genie bleibt Sieger, aber er wird die Anerkennung nicht ernten. Auch Wolfs ehemaliger Polizeibeamter und nunmehriger Rettungsfahrer, der 47jährige Brenner, muß für zwei Tage ins Gefängnis, bis endlich alles aufgeklärt ist. Etwas salopp könnte man formulieren: Der Kriminalroman rettet die private Initiative in einer verwalteten Welt. Er ist immer noch auf Identifikation angelegt, vor allem soll er uns durch seine Schwächen sympathisch werden. So legt der Kriminalroman heute immer noch eine Form des Protestes ein gegen die Bürokratie und gegen die Technokratie, und Sjöwall/Wahlöös Martin Becker ist das Musterbeispiel für einen Detektiv, der die technischen Daten nur braucht als Informationen; die Intuition kann durch diese nicht ersetzt werden. Mit diesem harten Rest von Individualität zu spekulieren ist sicher ein nicht unwesentlicher Teil des Erfolgsrezepts. Brenner hat sich schon zurückgezogen; ein bemerkenswerter Zug der modernen Detiktivromane ist eben dieses Agieren der Helden aus dem Ruhestand. Diese Reaktivierung findet sich in einer großen Anzahl von Romanen; es ist, als würde so die gute alte und leider vergangene Zeit wieder zum Leben erweckt.
Vielleicht ist es auch besser, in diesem Zusammenhang manchmal von Detektivroman und nicht von Kriminalroman zu sprechen; bei Haas kommt diesem eine zentrale Rolle zu, aber doch geht es mehr um das Szenario, in dem sich das Verbrechen abspielt. Das Szenario stellt die Stadt bereit; ich beobachte in der letzten Zeit eine deutliche Verlagerung des Kriminalgeschehens vom Lande oder dem Dorf beziehungsweise der Kleinstadt in die Metropole. Die Großstadt mit ihrer smarten Oberfläche, mit ihrem dem Scheine nach funktionierenden Betrieb verdient es immer aufs neue, enttarnt zu werden. Die Landeinsamkeit ist völlig ungeeignet für die Kriminalerzählung, weil hier jeder jeden kennt und das Verbrechen daher in einer anderen Weise ruchbar werden muß als in der Stadt. In jedem Falle liest der Detektiv selten im Buch der Natur er liest im Buch der Großstadt, deren Zeichensprache er zu dekodieren hat. (Auch in den Stockinger-Filmen sind es die Menschen, die über die Natur hergezogen sind.) Wien ist bis jetzt – könnte man sagen – eine Stadt ohne Detektiv geblieben.
Ich meine aber auch, daß ein Brenner nicht das Zeug hat, zu dem für Wien typischen Detektiv zu werden doch der Roman hat sehr wohl gute Chancen. Der Inhalt ist schnell erzählt: Der Rettungsfahrer Brenner wird Zeuge eines Mordes, eines Doppelmordes: Man meint, er gälte einem Mann, tatsächlich aber gilt er der Frau, die dieser leidenschaftlich küßt, als der tödliche Schuß fällt. Die Kugel durchbohrt beide. Diese Tat ist ebenso raffiniert wie unglaublich, denn der Täter hat den Mann ja gerne mitgenommen, weil er so die Verfolger auf die falsche Spur bringt – nicht der Mann sollte getötet werden, sondern Irmi, die ja den Missetaten des »Juniors«, des Chefs der Kreuzretter, auf der Spur ist. Dann wird noch einer umgebracht, ein Mittäter und ein Mitwisser – und dann tappt man im Dunklen; typisch ist die Anhäufung der Episoden, die alle dafür sorgen, daß wir stets neue Fäden der Erzählung aufnehmen müssen. Darauf möchte ich nun nicht eingehen, sondern viel eher auf die Technik; vieles an diesen Büchern bedient den Leser mit Konventionellem, einfach mit Momenten, die der Erfüllung des Schemas im Dienste des Genres dienen.
Doch die entscheidende Leistung liegt zweifelsfrei in der Erzähltechnik. Mit einer Beharrlichkeit, die fast befremdlich ist, wiederholt Haas die Einleitungssätze seiner Romane: »Jetzt ist schon wieder was passiert.« Im modernen Kriminalroman ist keine Platz für Gelassenheit oder für epische Distanz; es muß alles schnell geschehen, und Sinnbild dafür ist schon die erste Szene, die Wahnsinnsfahrt mit dem Rettungswagen ist symptomatisch für das Romanganze: Noch dazu ist es Manfred »Bimbo« Groß, der diese Risiko eingeht, der raffinierte Mörder, denn er ist es, der diesen Schuß abgibt – und es geht doch um nichts anderes als um die letzte Leberkässemmel ... Natürlich wird der Leser nicht mit den Informationen versorgt, die als unentbehrlich zur Lösung des Rätsels gelten müssen. Er bleibt damit auf der Strecke, im wahrsten Sinne des Wortes. Man könnte sagen: Haas bringt die Leser von des Rätsels Lösung weniger durch die geschickte analytische Art des Erzählens ab, als vielmehr durch das stilistische Beiwerk, durch eine Fülle von Informationen, die mit der Handlung nichts zu tun haben. Wir werden mit einer Fülle von Informationen überschüttet, aber sie alle scheinen auf den ersten Blick wenig oder nichts zur Lösung des Rätsels beizutragen. Natürlich muß in einem solchen Roman ausführlich das Lokale präsent sein, das Atmosphärische. Da genügen ein paar kräftig gesetzte Striche, und vor uns entsteht das Ekelhafte und Elende, das Drollige und Makabre; das alles ergibt diesen undurchdringlichen Filz, aus dem das Leben in Österreich nun einmal ist und der sich im Offiziellen eingenistet hat und ohne den ein öffentliches Leben hierzulande kaum mehr denkbar wäre. Dieses Myzel der Macht kann man zwar nicht zerschlagen, man muß es zerreißen, aber dann hat man sich erst recht in diesen Fäden verfangen. So steht am Ende auch nicht die Befreiung, sondern der Katzenjammer: Becker legt sich nach dem Donauinselfest zu den Betrunkenen auf die Donauinsel – und landet mitten im Müll. Was von der Stadt bleibt, das ist der Müll: »Heute reist ja sogar schon der Müll.« (109) Offenkundig ist der Text aus dem Bewußtsein heraus geschrieben, daß wir dem Müll – so oder so – nicht entkommen. Und wir sind mitten drinnen in diesem Sprachmüll, den Elfriede Jelinek auch in ihren Texten abgelagert hat.
Gerade im Umgang mit der Sprache liegt m.E. das Besondere dieser Leistung. Zunächst versteht sich der Sprachwissenschaftler Wolf Haas auf den Jargon. Es wäre einmal durchaus sinnvoll, die unterschiedlichen Rollen eben dieses Jargons in den verschiedenen Texten seit der Jahrhundertwende (Remarque, Horváth) zu untersuchen. Nun kopiert aber Haas weniger einen bestimmten Jargon; ihm geht es vielmehr um die Abkürzungen, um die Brachylogien: »Und die Saison mit den Schülerselbstmorden hat auch nicht nicht so richtig angefangen, weil Zeugnisverteilung erst in fünf Wochen.« (17) Oder: »Jetzt rote Ampel verboten.« (6) So stehen auch Nebensätze, was sie ja partout nicht dürfen, immer wieder allein (vgl. »Weil Tod feststellen nur Arzt.«; 13).
Das Kunstmittel der Ellipse, der Brachylogie ist zum Markenzeichen dieser Sprache geworden. Hier wird ausgelassen, ein mitunter riskantes Unterfangen. Es fragt sich: Wie viel kann ich unterschlagen und doch die Information erhalten. Dieses Stilmittel – und ich erblicke darin keine Abhängigkeit, aber nur zufällig kann es auch nicht sein – erinnert natürlich sehr deutlich an die Praktiken der Marlene Streeruwitz. Ich weiß aber gar nicht, ob es richtig ist, immer von Ellipsen zu sprechen. Manchmal scheinen es emphatisch gesetzte Nominative, kurzum Wortballungen zu sein, die des Verbs entbehren können. Der Verzicht auf das Verbum ist einerseits Unfähigkeit des Stilmittels, das die Dramatik erhöht, zugleich aber auch das Erzählen an sich untergräbt. Es wären ja auch »Erzählungen« ohne Verb denkbar – aber das würde doch einigermaßen holperig abgehen, zugleich aber wäre damit eine größere Ökonomie erreicht.
Wichtig ist, daß hier aus keiner bestimmten Perspektive erzählt wird. Manchmal sind wir zwar an die Brenners gebunden, aber nicht durchgehend. Im ersten Kapitel ist wieder so eine Instanz, die alles zu organisieren scheint, die über den Jargon verfügt. Aber sie sagt uns nicht, was wirklich los war mit dem Manfred »Bimbo« Groß, der unter dem Vorwand sich eine Semmel zu kaufen, einfach zwei Leute abknallt.
In jedem Falle dominiert in der Sprache die Umschreibung, die Metapher, die Litotes: Das stellt eine Querverbindung zu Jelinek her; kaum etwas wird direkt zum Ausdruck gebracht; der Leser ist gezwungen, diesen Umwegen zu folgen, sich über sie zum Ziel leiten zu lassen. Das erinnert an das Verfahren Elfriede Jelineks. Es würde sich überhaupt einmal lohnen, diese Stilfiguren der Periphrase in der österreichischen Literatur etwas genauer zu untersuchen. Auch Allegorien werde immer wieder herbeizitiert:
Wenn du heute als Detektiv zuviel an den Tod denkst, kann es leicht passieren, daß der Tod zur Abwechslung auch einmal an dich denkt. Obwohl man ja sagt, daß der Tod eine kalte Hand hat. Und die Hand, die dem Brenner jetzt von hinten den Hals zugedrückt hat, ist eine warme Hand gewesen. (141) Das ist die Kunst des Übergangs: Von dem Bild der kalten Hand des Todes, also von der doch ziemlich verbrauchten Allegorie schlägt die Erzählung mit einem Schlage in Handlung um. Weiter: Und die Hand, die ihm den Arm auf den Rücken gedreht hat, hat sich auch ganz normal angefühlt. Ich möchte nicht sagen menschlich, weil wenn dir jemand halb die Schulter auskegelt, sagt man nicht gern menschlich, Temperatur hin oder her. (141)
Hier wird die Redewendung beim Wort genommen, sie wird gleichsam Fleisch: Die kalte Hand des Todes, die nun die warme Hand eines Menschen ist, der nicht menschlich ist. Das Spiel mit den verschiedenen Bedeutungen des Wortes menschlich gibt solchen Partien ihren Reiz. Zugleich aber wird so das Erzählen an sich umgangen; es wird nicht direkt erzählt, sondern alles in ein Indirektes ausgelagert, und dies macht, so möchte ich meinen, doch auch die Stärke dieses Textes aus. Zugleich ist es ein Signal für die gewählte Umständlichkeit. Die Omnipräsenz des Todes wird an dieser Stelle ebenso schön erkennbar: Schon aus dem Titel klingt sie an, ein Zitat, das Brenner offenkundig nicht ganz richtig im Gedächtnis hat, denn der Text lautet »Komm, süßes Kreuz« und erweist sich als Aria in der Bachschen Matthäus-Passion. (158, 194) Dieses Zitat ist der thematische Integrationspunkt des ganzen Textes, ein sehr ironisch gewählter Integrationspunkt, wenn man bedenkt, daß der »süße Tod« durch eine Zuckerwasserlösung herbeigeführt wird. Bimbo wird auf makabre Weise umgebracht. Da heißt es: »Der Groß ist tot!« Das wird von Brenner umgedreht: »Der Tod ist groß.« Und er weiß dazu auch das einschlägige Gedicht – von einem Trauerbillet. »Der Tod ist vielleicht groß«, beginnt das 13. Kapitel, und weiter heißt es: »Wien ist auch groß.« (165) Das ist ein – durch das »vielleicht« allerdings entscheidend variiertes – Rilke-Zitat, mit dem eine andere Ebene der Todesthematik eingeführt wird: Wir sind des Todes, lachenden Mundes. Entscheidend ist allerdings, wie durch das »tertium comparationis« »groß« die Beziehung zwischen Wien und Tod blitzartig hergestellt wird: So wird Wien gleichsam zur Stadt des Todes oder der Toten, ein Topos, der sich immer wieder reaktivieren ließe. In diesem Roman gerät so die Handlung, ja selbst das Atmosphärische unter die Oberhoheit der Sprache, des Stils, der Stilfiguren, einer uneigentlichen Redeweise, die einen Sog entwickelt und eine eigene Kunstfertigkeit herstellt, die das Geschehen als ein in höchstem Maße künstliches ausweisen will. Dem steht die perfekte Beherrschung des Jargons gegenüber, der das Gegengewicht zu dieser Form der extremen Künstlichkeit darstellt. Doch wird dieser Text durchgehend vom Todesbewußtsein dominiert, und allenthalben geht es um die Feststellung des Todes. Wir werden nirgends aus dieser Todesperspektive entlassen, wobei gerade die Art, in der in diesem Text der Tod zum Leben erweckt wird, stets für groteske Kontraste sorgt. Und es ist gerade diese Balance des Komischen und des Tragischen, die solche Texte auch am Leben erhält und sie jeder vorschnellen Verfügbarkeit entzieht und dadurch realistisch in einer Weise wird, die sowohl dem Komischen wie dem Tragischen – tritt es unvermischt auf – versagt bleibt.
Franzobel: Scala Santa oder Josefine Wurznbachers Höhepunkt (2000)
Franzobel (eigentlich Franz Stefan Griebl, *1967), gehörte nach seinem Erfolg beim Bachmann-Preis 1995 dazu: Seinem preisgekrönten Text Krautflut folgte eine Flut von weiteren Texten, die allesamt in der Nachfolge der experimentellen der Literatur der Wiener Gruppe und Ernst Jandls zu stehen scheinen. Franzobel verstand sich darauf, diese radikale Literatur populär zu machen, indem er das Sprachspiel systematisch einsetzte und dabei auch eine gewisse Durchsichtigkeit sowohl des Verfahrens als auch der Intention gewährtleistete, selten aber konkrete Inhalte anbot, die denn auch transportierbar oder gar nacherzählbar wären. Das änderte sich ein wenig mit dem Buch Scala Santa aus dem Jahr 2000. Das ist kein Buch für das Heilige Jahr, denn der Titel legt mit Eindeutigkeit Zweideutiges Nahe, ein Verdacht, der durch marginale Erwähnung des Namens Salten noch verstärkt wird: Freilich begegnet auch »Römisches«, aber der Ausgangspunkt ist doch das Wiener »Milieu«, das bei der »Mutzenbacher« gemeint ist, dazu aber auch noch die hohe und mittlere Geistlichkeit. Daß es mit einem Mord beginnt, sich mit Morden fortsetzt und am Ende mit einer Mordskatastrophe schließt, legt auch den Verdacht nahe, daß wir es mit einem Kriminalroman zu tun haben, denn der – eher erfolglose – Kommissar namens Sixtus Ponstingl-Ribisl ist um die Klärung des Verbrechens bemüht, das am Ende nur durch ein Massensterben irrelevant wird. Wie in jedem guten Kriminalroman geht es weniger um die Lösung des Rätsels als um die stets neue Verrätselung, die sich am Ende nur als Ergebnis der Lust des Erzählers zur fortgesetzten Irreführung offenbart, und dem geneigten Leser sei geraten, von dem Ganzen mehr Kottan als Maigret und mehr Stockinger als Philip Marlowe zu erwarten. In jedem Falle gilt es, von der ersten Zeile an jeden Realismusverdacht zu suspendieren. Es gibt Mord und Totschlag, der grausame Stoff, von dem die Chronik der Boulevardpresse sich nährt, wird pur geboten.
Zugleich sind wir in einer Welt extremer Künstlichkeit, die Wienerisches und Römisches, Weltliches und Kirchliches, Erhabenes und Banales, Moralisches und Frivoles gleichsam als das Eingemachte konserviert, über das sonst so gehandelt wird, als würde in der Literatur ein Sachverhalt und nicht ein Sprachverhalt vorgeführt. Schon die Namen der Figuren suggerieren die grundsätzlich satirische Intention: Ludovica Hasentütl, Luipold Nehoda, Klementine Zitzelfeiger, der Pfarrer Hutwelker, der Bischof Finocci, Edelburg Semmelrath, Baruch Weinzwang, Severin Roßleimer, Karol Knechtl, Quasimodo Leopold usw. Fast jede dieser Figuren ist Anlaß, aus ihnen heraus eine Nebenstory zu entwickeln, die in irgendeinem verqueren Zusammenhang zur Hauptstory zu stehen scheint, doch wehe dem, der hinter alledem irgendeine Notwendigkeit vermuten würde. Ein Wort gibt das andere, die bizarren Situationen vermehren sich durch Jungfernzeugung ins Unüberschaubare und lassen jeden Versuch einer Inhaltsangabe zur Karikatur seiner selbst werden. Weil das Buch zu viele Inhalte hat, hat es zu guter Letzt eben keinen, auf den es ankäme. Dieser eine Roman parodiert alle möglichen Romane und ist damit auch zur Parodie der literarischen Ambition geworden, der er sein Entstehen verdankt. Er bezieht, wie so viele Texte österreichischer Autoren, sein Sprachmaterial aus der Liturgie und aus der Bibel, das Hohe Lied und die Paulusbriefe wird man sofort erkennen, aber gerade die Zitate aus diesen Gebilden stehen in einem nicht selten bestürzend komischen Kontrast zur Umgebung:
Meine Taube im Felsennest, versteckt an der Steilwand, dein Gesicht laß mich sehen, deine Stimme hören! Komm doch, komm. Denn süß ist seine Stimme, lieblich sein Gesicht. Es riecht nach Nest, nach ausgepacktem Luipold Nehoda. (Franzobel 2000, 99)
Durchgehend zersetzt die Essigsäure des Banalen die Aura des Sakralen, und der arme Leser, der einmal Halt finden möchte, ist dieser Kraut-Springflut der Worte ausgesetzt, die man selbst bei einiger Anstrengung nur schwer unter die Kontrolle zu bekommen vermag, welche man aber benötigen würde, um sich ein Bild vom Ganzen zu machen. So wie der Autor es vormacht, so muß sich der Leser dem Detail hingeben, und wird nicht selten dafür belohnt, manchmal allerdings auch verärgert, weil er sich fragt ob der Aufwand der Rekonstruktion eines Zusammenhanges sich lohnt, der sich ja letztlich auch nur als ein Schein offenbart. Natürlich wird man auch durch eine Menge Gags belohnt, in Form von Enthüllungen, wie etwa der, daß der Pfarrer Hutwelker eigentlich Frau und Mutter ist, woraus sich wieder neue verwirrende Konstellationen ergeben.
Die Stärke Franzobels liegt in den Bildern und Vergleichen, in den mitunter recht kühnen Metaphern, die nie klischiert, aber nicht selten doch etwas zu bemüht wirken. Doch gelingen auch manchmal Bilder, die den Witz und die innovative Qualität der Vergleiche eines Jean Paul haben, der – auch hierin mit Franzobel vergleichbar – seine Gedanken und seine Handlung an diese Metaphernlust verlor. Freilich gelingt solches nicht immer, und nicht selten können solche Vergleiche nur als ironisches Zitat verstanden werden, das sich durch seine Banalität selbst decouvriert: »Die Welt ist ein Purzelbaum, ein Fehler und ein Unsinn, ganz pervers, ein Gruselkabinett und eine Folterkammer.« Am gelungensten sind solche Bilder, in denen die Manieriertheit zu sich selbst auf Distanz geht und doch als ein angemessenes Verfahren entpuppt. Über die tote Großmutter Edelburg Semmelrath im Sarg heißt es:
In ein weißes Kleid war sie gelegt, sah aus wie Zucker, ein Eiklar Zufriedenheit dazugemischt, als ob ein allmächtiger Konditor ihre Verbissenheit, an der sie ein Leben zu nagen gehabt hatte, herausgelöst hätte, um sie mit einer süßen Creme zu füllen. (Franzobel, 56) Der päderastische Bischof Finocci wird am Ende vom Himmel gestraft – es gab »einen Knall, ein Zischen, und der Bischof wurde in den Boden eingedrückt.« (Franzobel 2000, 381) Und dann kommt eines der Bilder, die Franzobels Texten allemal mit einem Gütesiegel versehen: »Als hätte sich der Schöpflöffel Gottes persönlich herabgelassen, ihn wie einen Leberknödel anzustechen.« (ebda) Besonders geglückt sind die Bilder dann, wenn er mit sinnlicher Sicherheit den Sprachbrei auslöffelt und ihm Gestalt verleiht. Daher lohnt es sich auch, bis zum Ende auszuharren, dem Höhepunkt des Romans, in dem alles – so will es der Geist der Erzählung – auf der Scala Santa in Rom, wo das vorgeschriebene Ritual statt zur Erlösung zum makabren Finale mit allen grotesken Nebeneffekten führt, endet.
Primärliteratur
- Achleitner, Friedrich: Die Plotteggs kommen. Ein Bericht. Wien: Sonderzahl 1995.
- Bachmann, Ingeborg: Unter Mördern und Irren. In: Dies.: Werke. Hrsg. von Christine Koschel u.a. 2. Bd, München-Zürich: Piper 1978.
- Bernhard, Thomas: Heldenplatz. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1988.
- Bernhard, Thomas: Alte Meister. Komödie. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1985.
- Bernhard, Thomas: Auslöschung. Ein Zerfall. Berlin-Wien: Koch 1986. (Die Ziffern im fortlaufenden Texte beziehen sich auf diese Ausgabe.)
- Bernhard, Thomas: Holzfällen. Eine Erregung. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1984.
- Czernin, Franz Josef: Anna und Franz. Sechzehn Arabesken. Innsbruck: Haymon 1998.
- Döblin, Alfred: Berlin Alexanderplatz. Die Geschichte vom Franz Biberkopf. München: dtv 1997 (Berlin: S. Fischer 1929).
- Eco, Umberto: Der Name der Rose. Roman. Aus dem Italienischen von Burkhart Kroeber. München-Wien: Hanser 1982 [ital.: Il nome dedlla rosa. Milano: Gruppo Editorale Fabbri-Bompiani, Sonzogno, Etas S. p. A. 1980].
- Elfriede, Jelinek: Die Kinder der Toten. Roman. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1995.
- Fanzobel: Die Krautflut. Erzählung. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995.
- Franzobel: Scala Santa oder Josefine Wurznbachers Höhepunkt. Roman. Wien: Zsolnay 2000.
- Gauß, Karl-Markus: Ritter, Tod und Teufel. Klagenfurt-Salzburg: Wieser 1994.
- Grond, Walter: Homer absolut. [Die Akte Odysseus]. Gaz-Wien: Droschl 1995.
- Gstrein, Norbert: Die englischen Jahre. Roman. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1999.
- Haas, Wolf: Komm, süßer Tod. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1998.
- Handke, Peter: Am Felsfenster, morgens. In: manuskripte 97/1987, 3.
- Handke, Peter: Das Spiel vom Fragen oder Die Reise zum sonoren Land. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1989.
- Handke, Peter: Der Versuch über den geglückten Tag. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1991.
- Handke, Peter: Der Versuch über die Jukebox. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1990.
- Handke, Peter: Der Versuch über die Müdigkeit. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1989.
- Handke, Peter: Die Lehre der Sainte Victoire. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1981.
- Handke, Peter: Die Stunde der wahren Empfindung. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1975.
- Handke, Peter: Eine neue Lehre der Sainte Victoire. Salzburg-Wien: Residenz 1990.
- Handke, Peter: Epopöe vom Verschwinden der Wege oder Eine andere Lehre der Sainte Victoire. In: Noch einmal für Thukydides. Salzburg-Wien: Residenz 1990, 35-38.
- Handke, Peter: Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1972. (= Suhrkamp-Tb; 56)
- Handke, Peter: Mein Jahr in der Niemandsbucht. Ein Märchen aus den neuen Zeiten. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1994.
- Handke, Peter: Über die Dörfer. Dramatisches Gedicht. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1981.
- Handke, Peter: Wunschloses Unglück. Erzählung. Salzburg: Residenz 1972.
- Handke, Peter: Zurüstungen für die Unsterblichkeit. Ein Königsdrama. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1997.
- Hanke, Peter: Die Wiederholung. Frankfurt/M: Suhrkamp 1986.
- Haslinger, Josef: Der Tod des Kleinhäuslers Ignaz Hajek. Novelle. Darmstadt: Luchterhand 1985.
- Haslinger, Josef: Hausdurchsuchung im Elfenbeinturm. Frankfurt/M.: Fischer 1996.
- Haslinger, Josef: Opernball. Roman. Frankfurt/M.: Fischer 1995.
- Hein, Christoph: Horns Ende. Roman. Darmstadt u.a.: Luchterhand 1985.
- Jandl, Ernst: älterndes paar. ein oratorium. In: idyllen. Hamburg-Zürich: Literaturverlag Luchterhand 1989, 122-125. (Im folgenden zitiert als: Jandl 1989.)
- Jandl, Ernst: porträt des schachspielers als trinkende uhr. In: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. 2. Gedichte. Darmstadt und Neuwied: Luchterhand 1985.
- Jandl, Ernst: stanzen. Darmstadt: Luchterhand 1992.
- Jandl, Ernst: Voraussetzungen, Beispiele und Ziele einer poetischen Arbeitsweise. Ein Vortrag. In: Ders.: Gesammelte Werke. Neuwied-Darmstadt: Luchterhand, 480-489.
- Jelinek, Elfriede: Die Macht und ihre Preisliste (zu den Theaterstücken Marlene Streeruwitz'). In: Marlene Streeruwitz: Waikiki-Beach. Und andere Orte. Die Theaterstücke. Frankfurt/M.: Fischer 1999, VII-XVI.
- Jelinek, Elfriede: Oh Wildnis, oh Schutz vor ihr. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1985.
- Jelinek. Elfriede: Die Liebhaberinnen. Roman. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1980.
- Kofler, Werner: Am Schreibtisch. Alpensagen/ Reisebilder/Racheakte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1988.
- Kofler, Werner: Der Hirt auf dem Felsen. Ein Prosastück. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1991.
- Kofler, Werner: Hotel Mordschein: Mutmaßungen über die Königin der Nacht. Drei Prosastücke. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt 1989.
- Köhlmaier, Michael: Kalypso. Roman. München: Piper 1997.
- Köhlmaier, Michael: Telemach. Roman. München: Piper 1995.
- Lukács, Georg: Die Theorie des Romans. Ein geschichtsphilosophischer Versuch über die Formen der großen Epik. Mit dem Vorwort von 1962. München: dtv 1994 (1920).
- Mayröcker, Friederike: brütt oder Die seufzenden Gärten. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998.
- Menasse, Robert: Phänomenologie der Entgeisterung. Geschichte des Verschwindens des Wissens. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995.
- Menasse, Robert: Schubumkehr. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995.
- Menasse, Robert: Schubumkehr. Roman. Salzburg-Wien: Residenz 1995.
- Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften. 2 Bde. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1970.
- Nestroy, Johann: Der Talisman. In: Ders.: Werke. 6 Bdn. Bd. 4.: Hrsg. v. Otto Rommel. Wien: Schroll 1962.
- Nestroy, Johann: Der Zerrissene. In: Ders.: Werke. 6 Bdn. Bd. 3: Hrsg. v. Otto Rommel. Wien: Schroll 1962.
- Ovid = Publius Ovidius Naso: Metamorphosen. Epos in 15 Büchern. Übersetzt und hrsg. von Hermann Breitenbach. Mit einer Einleitung von L.P. Wilkinson. Stuttgart: Reclam 1964 (= RUB 356).
- Ovid = Publius Ovidius Naso: Metamorphosen. Lateinisch - deutsch. In deutsche Hexameter übertragen und hrsg. von Erich Rösch. Mit einer Einführung von Niklas Holzberg. München: Artemis und Wikler 131992.
- Pynchon, Thomas: Die Enden der Parabel. Gravity's Rainbow. Übers. von Elfriede Jelinek, Thomas Piltz. Reinbek bei Hamburg 1984.
- Ransmayr, Christoph: Der Weg nach Surabaya. Reportagen und kleine Prosa. Reportagen und kleine Prosa. Frankfurt/ M.: S. Fischer 1997.
- Ransmayr, Christoph: Die letzte Welt. Roman. Mit einem Ovidischen Repetoire. Nördlingen: Franz Greno 1988, 111. (= Die Andere Bibliothek; 44) (Die Ziffern im fortlaufenden Texte beziehen sich auf diese Ausgabe.)
- Ransmayr, Christoph: Die Schrecken des Eises und der Finsternis. Roman. Wien-München: Edition Brandtstätter 1984. (= Fischer Taschenbuch Bd. 5419)
- Ransmayr, Christoph: Morbus Kitahara. Frankfurt/M.: S. Fischer 1995.
- Ransmayr, Christoph: Strahlender Untergang. Ein Entwässerungsprojekt oder die Entdeckung des Wesentlichen. Wien-München: Edition Brandtstätter 1982. (Neuausgabe 2000 bei S. Fischer.)
- Reichart, Elisabeth: Lächeln der Amaterasu. Roman. Berlin: Aufbau 1998.
- Rosei, Peter: Versuch, die Natur zu kritisieren. Salzburg: Residenz 1982.
- Roth, Gerhard: Archive des Schweigens = Bd. 1: Im tiefen Österreich. Bildtextband (1990); Bd. 2: Der Stille Ozean. Roman (1980); Bd. 3: Landläufiger Tod. Roman (1984); Bd. 4: Am Abgrund. Roman (1986); Bd. 5: Der Untersuchungsrichter. Roman (1988); Bd. 6: Die Geschichte der Dunkelheit. Bericht (1991); Bd. 6: Eine Reise in das Innere von Wien. Essays (1991). Alle Frankfurt/M.: S. Fischer.
- Roth, Gerhard: Der Berg. Roman. Frankfurt/M.: Suhrkamp 2000.
- Roth, Gerhard: Der Plan. Roman. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998.
- Roth, Gerhard: Die Geschichte der Dunkelheit. Ein Bericht. Frankfurt/M.: S. Fischer 1991.
- Roth, Joseph: Radetzkymarsch. Roman. In: Joseph Roth: Werke. Bd. 5. Hrsg. v. Fritz Hackert und Klaus Westermann. Bd. 1-6. Köln: Kiepenheuer & Witsch 1989-1991, 137-455.
- Scharang, Michael: Das Jüngste Gericht des Michelangelo Spatz. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1998.
- Scharang, Michael: Schluß mit dem Erzählen und andere Erzählungen. Neuwied 1970.
- Schindel, Robert: Gebürtig. Roman. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1992.
- Schindel, Robert: Gott schütz uns vor den guten Menschen. Jüdisches Gedächtnis – Auskunftsbüro der Angst. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1995.
- Schlag, Evelyn: Die göttliche Ordnung der Begierden. Salzburg-Wien: Residenz 1998.
- Schmatz, Ferdinand: das große babel,n. Innsbruck: Haymon 1999.
- Schmatz, Ferdinand: Sprache, Macht, Gewalt. Stichwörter zu einem Fragment des Gemeinen. Wien: Sonderzahl 1994.
- Schwab, Werner: Der Dreck und das Gute. Das Gute und der Dreck 1992.
- Schwab, Werner: DER REIZENDE REIGEN nach dem Reigen des REIZENDEN HERRN ARTHUR SCHNITZLER. Wien-Graz: Droschl 1996.
- Schwab, Werner: DIE PRÄSIDENTINNEN: In: Fäkaliendramen. Wien-Graz: Droschl 1992, 11-58.
- Schwab, Werner: HOCHSCHWAB. In: Königskomödien. Wien-Graz: Droschl 1992, 63-119.
- Schwab, Werner: OFFENE GRUBEN OFFENE FENSTER. EIN FALL von Ersprechen. In: Königskomödien. Wien-Graz: Droschl 1992, 7-62.
- Sperber, Manès: Die Wasserträger Gottes. All das Vergangene. Wien: Europa 1974.
- Stifter, Adalbert: Abdias. Novelle. In: Ders.: Gesammelte Werke. Bd. 1. Hrsg. v. Dietmar Grieser. München: Nymphenburger 1982, 359-460 [erstmals in: Österreichischer Novellen-Almanach. Wien 1843].
- Stifter, Adalbert: Die Mappe meines Urgroßvaters. Hrsg.v. Karl Pörnbacher. Stuttgart: Reclam 1988. [erstmals: Ders.: Urmappe. In: Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, Theater und Mode. Wien 1841/42].
- Stifter, Adalbert: Studien. München: Winkler 1950, 487 [erstmals: Ders: Studien. Pest-Leipzig 1844-1850 (6 Bde.)].
- Streeruwitz, Marlene: Können. Mögen. Dürfen. Sollen. Wollen. Müssen. Lassen. Frankfurter Poetikvorlesungen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998.
- Streeruwitz, Marlene: Sein. Und Schein. Und Erscheinen. Tübinger Poetikvorlesungen. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1997.
- Streeruwitz, Marlene: Waikiki-Beach. Und andere Orte. Die Theaterstücke. Frankfurt/M.: Fischer 1999.
- Wiener, Oswald: Verbesserung von Mitteleuropa. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1969.
- Winkler, Josef: Das Zöglingsheft des Jean Genet. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1992.
- Winkler, Josef: Domra. Am Ufer des Ganges. Roman. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1996.
- Winkler, Josef: Friedhof der bitteren Orangen. Roman. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1990.
- 12. Sekundärliteratur
- Batt, Kurt: Revolte intern. Betrachtungen zur Literatur in der Bundesrepublik Deutschland. München: Beck 1975.
- Blumenberg, Hans: Arbeit am Mythos. 2. durchges. Aufl. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1981.
- Botond, Anneliese (Hrsg.): Über Thomas Bernhard. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1970.
- Brill, Siegfried: Komödie der Sprache. Erlanger Beiträge zur Spach- und Kunstwissenschaft 1967.
- Czernin, Franz Josef: Zu Ernst Jandls 'stanzen'. In: Ders.: Apfelessen mit Swedenborg. Essays zur Literatur. Düsseldorf: Grupello 2000.
- Greiner, Bernd: Die Morgenthau-Legende: Zur Geschichte eines umstrittenen Plans. Hamburg: Hamburger Edition. 1995.
- Gürtler, Christa: Die Entschleierung der Mythen von Natur und Sexualität. In: Gegen den schönen Schein. Texte zu Elfriede Jelinek. Frankfurt/M.: neue kritik 1990, 120-134.
- Gürtler, Christa: Die Entschleierung der Mythen von Natur und Sexualität. In: Gegen den schönen Schein. Texte zu Elfriede Jelinek. Frankfurt/M.: neue kritik 1990, 120-134.
- Haas, Franz: Bücher aus dem Hinterhalt. Die literarischen Sabotageakte des österreichischen Schriftstellers Werner Kofler: Eine Hommage. In: Frankfurter Rundschau, 4.8.1990.
- Hibele, Hans H.: Elfriede Jelineks satirisches Prosagedicht 'Lust'. In: Sprachkunst (1992), 296-298.
- Jelinek, Elfriede: Atemlos. In: Thomas Bernhard. Portraits. Bilder und Texte. Hrsg. v. Sepp Dreissinger. Weitra: Bibliothek der Provinz 1991, 311.
- Lau, Jörg: Letzte Welten, umgrenztes Ich. In: Merkur 1996.
- Löffler, Sigrid: Am Eingang zur Unterwelt. Zum neuen Roman von Elfriede Jelinek: 'Die Kinder der Toten'. In: Süddeutsche Zeitung 11.8. 1995.
- Jelineks Wahl. Literarische Verwandtschaften. Hrsg. v. Elfriede Jelinek u. Brigitte Landes. München: Goldmann 1998.
- Kaukoreit, Volker: Robert Schindel. In: Kritisches Lexikon der Gegenwartsliteratur (KLG), 51. Nlg. 1995, 1.
- Parker, Patricia: Metapher und Katachrese. In: Die paradoxe Metapher. Hrsg. von Andselm Haverkamp. Frankfurt/M.: Suhrkamp 1998, 312-331.
- Radisch, Iris: Maxima Moralia. Elfriede Jelinek und ihr österreichisches Gesamtkunstwerk. In: Die Zeit 1995, Nr. 38.
- Raddatz, Fritz J.: G. Lukács in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 1972, 145
- Rushdie, Salman: Christoph Ransmayr. In: Imaginary Homelands. Essays and Criticism 1981-1991. London 1991, 291-293.
- Schmidt-Dengler, Wendelin: Bernhards Scheltreden. Um- und Abwege der Bernhard-Rezeption. In: Ders.: Der Übertreibungskünstler. Studien zu Thomas Bernhard. 2. erw. Aufl., Wien: Sonderzahl 1989, 93-106.
- Vogel, Juliane: Elfriede Jelineks „Kinder der Toten". In: manuskripte 132 (1996), 110-111.
- Vogel, Juliane: Letzte Momente/Letzte Welten. Zu Christoph Ransmayrs ovidischen Etüden. In: Albert Berger u. Gerda Elisabeth Moser (Hrsg.): Jenseits des Diskurses. Literatur und Sprache in der Postmoderne. Wien: Passagen 1994.
- Vogel, Juliane: Wasser, hinunter, wohin? Elfriede Jelineks „Kinder der Toten" – ein Flüssigtext. In: Allysson Fiddler (ed.): 'Other' Austrians. Post-1945 Austrian Women's Writing. Proceedings of the conference held at the University of Nottingham from 18-20 April 1996. Berne: Peter Lang 1998, 235-242.
- Weinrich, Harald: Tempus. Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart 1964.
- Weinzierl, Ulrich: Die alte fesche Niedertracht. Zu Oh Wildnis, Oh Schutz vor ihr. (1985). In: Elfriede Jelinek. Dossier. Buchreihe über österreichische Autoren. Bnd. 2. Hrsg. v. Kurt Bartsch u. Günther A. Höfler. Graz-Wien: Droschl 1991, 212-214.
- Winter, Riki: Gespräch mit Elfriede Jelinek. In: Elfriede Jelinek. Dossier. Buchreihe über österreichische Autoren. Bnd. 2. Hrsg. v. Kurt Bartsch u. Günther A. Höfler. Graz-Wien: Droschl 1991, 9-19.
- Zeller, Christoph: Vom Eigenleben der Zeilen. Poetische Reflexionen in Ernst Jandls „idyllen". In: Sprachkunst 29 (1998), 85-104.
- Zeyringer, Klaus: Österreichische Literatur 1945 -1998. Überblicke, Einschnitte, Wegmarken. Innsbruck: Haymon 1999.
Danksagung und Rechte
Die Veröffentlichung der Beiträge wurde mit freundlicher Genehmigung des Autors ermöglicht.
.
Endnoten
- Schmidt-Dengler-Wendelin
- Haslinger-Josef
- Ransmayer-Christoph
- Menasse-Robert
- Jelinek-Elfriede
- Bernhard-Thomas
- Schwab-Werner
- Handke-Peter
- Streeruwitz-Marlene
- Haas-Wolf
- Jandl-Ernst
- Roth-Gerhard
- Reichart-Elisabeth
- Grond-Walter
- Abraham-a-Sancta-Clara
- Kraus-Karl
- Qualtinger-Helmut
- Nestroy-Johann
- Wien
- Universität-Wien
- Gegenwartsliteratur
- Österreich
- Neuere Deutsche Literatur
- Österreichische Literatur
- 602 Sprach- und Literaturwissenschaften
- Deutsch
- Graues Werk
- Werk